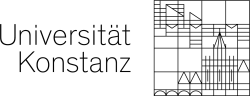„Equal Pay Day“: Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt – Interview mit Susanne Strauß
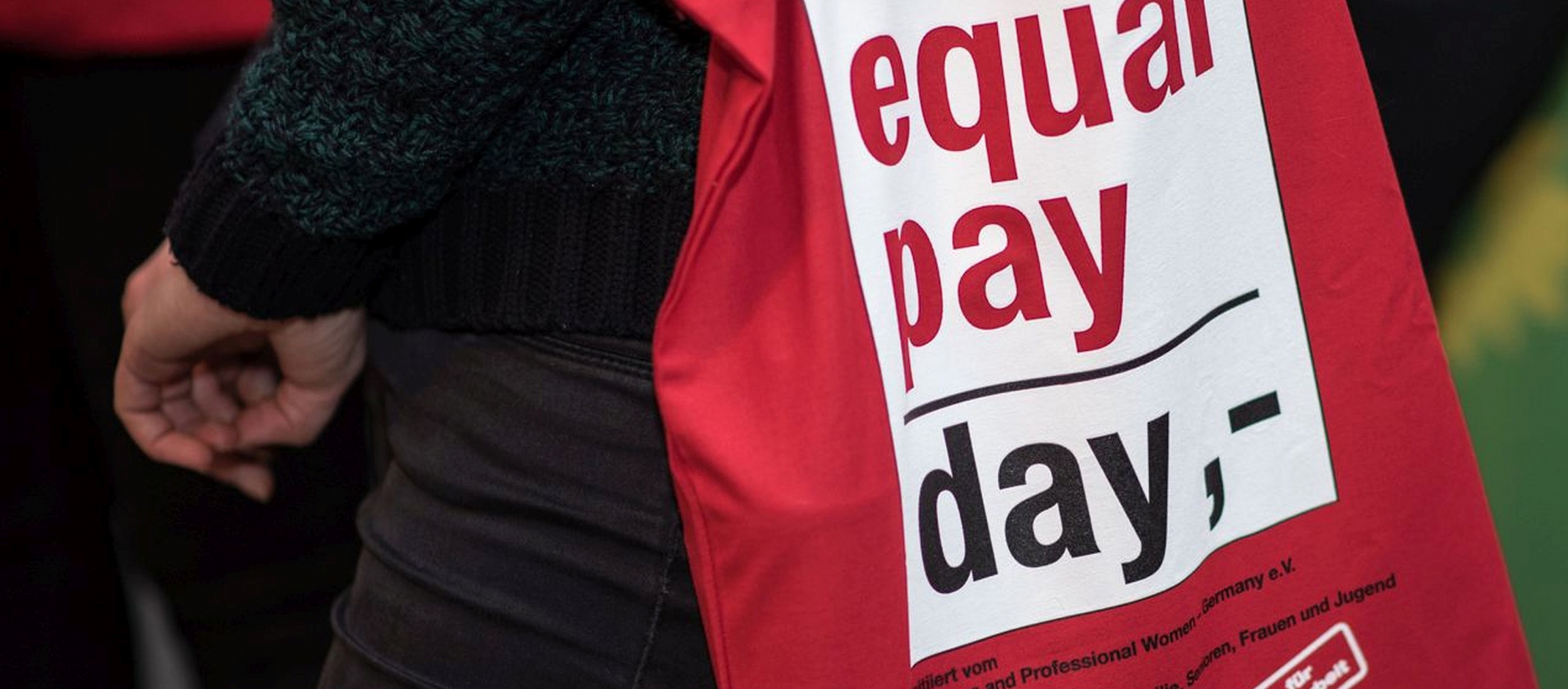
Frau Strauß, Sie forschen seit Jahren zum Thema Geschlechterungleichheit auf dem Arbeitsmarkt und in der Entlohnung von Erwerbstätigkeit. Worin besteht auf dem Arbeitsmarkt die entscheidende Ungleichheit zwischen den Geschlechtern?
Ich würde da zwei Punkte nennen. Der erste Punkt sind die unterschiedlichen Vorlieben von Frauen und Männern bei der Entscheidung für Ausbildung und Beruf. Wir nennen das „horizontale Segregation“, eine faktische Geschlechtertrennung, die von häufig getroffenen Entscheidungen über den eigenen Lebensweg herrührt. Wir beobachten, dass Frauen im Bildungssystem stark aufgeholt und die Männer teilweise überholt haben. Gleichzeitig wählen Frauen vielfach andere Berufsausbildungen und Studienfächer als Männer, und das hat Folgen für die Unterschiede in den Einkommen.
Männlich dominierte Fächer, etwa Ingenieurswissenschaften, bieten besser bezahlte Berufschancen als beispielsweise die Geisteswissenschaften, wo wir mehr Frauen antreffen. Das ist bekannt, und auch die Politik versucht dem entgegenzuwirken, unter anderem mit Aktionen wie dem „Girls‘ Day“ und „Boys‘ Day“.
„Boys‘ Day“?
Ja, da werden Jungs dann zum Beispiel in eine Kita gebracht, um sie zu motivieren, Erzieher zu werden. Erzieherin ist ja immer noch ein weit überwiegend von Frauen ausgeübter Beruf. Die Schwierigkeit, die wir hier sehen, liegt natürlich auf der Hand: Wenn der Erzieherberuf weiterhin so schlecht bezahlt ist, dann ist er einfach nicht attraktiv. Und dann bringt auch ein „Boys‘ Day“ nichts.
Ist denn dann die Berufswahl selbst das Problem oder die unterschiedliche Bezahlung verschiedener Berufsfelder?
Manche Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass Berufe, die sozusagen „verweiblichen“, also mit der Zeit einen steigenden Frauenanteil haben, über die Zeit auch schlechter bezahlt werden.
Eine Rolle spielt aber auch der Wandel mancher Berufe oder das Image eines Berufs. Beispielsweise waren Apotheker früher männlich, sind aber inzwischen eher weiblich dominiert. Dadurch verändert sich das „Sex Typing“ des Berufs: Das geschlechtsbezogene Tätigkeitsbild, das wir mit einem Beruf verbinden. Apotheker galt früher als ein technisch-chemielastiger Beruf. Inzwischen rückt er immer mehr in die Nähe einer Verkaufstätigkeit für Medikamente.
Das klingt nach Rückschritten. Hat es gar keine Fortschritte gegeben?
Die „Geschlechtertrennung“ auf dem Arbeitsmarkt hat insgesamt über die Jahrzehnte abgenommen. Aber nicht so stark, wie man in einer freiheitlichen Gesellschaft wie unserer erwarten sollte, wo jede und jeder den Beruf frei wählen kann. Das betrifft besonders die technik- und ingenieurwissenschaftlichen Fächer, da gibt es die berühmte „Leaky Pipeline“. Frauen steigen in diesen Fächern und den entsprechenden Berufen mit der Zeit eher aus als Männer: Die „Pipeline“, durch die Personen in Spitzenpositionen gelangen, hat quasi ein Leck.
Außerdem ist der Übergang in den Arbeitsmarkt ein Problem: Frauen, die in diesen Fächern erfolgreich abschließen, entscheiden sich eher als ihre männlichen Kommilitonen für ein anderes Berufsfeld.
Sie sprachen von zwei Punkten. Was verstärkt Geschlechterungleichheit am Arbeitsmarkt noch?
Der zweite Aspekt ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Da gibt es international zwar große Unterschiede. Aber überall ist es so, dass Frauen mehr an der unbezahlten Arbeit beteiligt sind als Männer, sowohl an der Hausarbeit als auch an der Kinderbetreuung. Das schlägt natürlich auf ihre Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt durch. In Ländern, in denen Frauen stärker in den Arbeitsmarkt integriert sind, etwa in den skandinavischen Ländern, arbeiten die Männer auch stärker im Haushalt mit – aber immer noch nicht im gleichen Umfang wie Frauen.
Einrichtungen für Kinderbetreuung spielen da eine große Rolle, und zwar nicht nur für die Erwerbsquote von Frauen, wie die Forschung zeigt: In Ländern, in denen die öffentliche Infrastruktur für Kinderbetreuung schlecht ausgebaut ist, ist auch die Geburtenrate meist extrem niedrig. Ein typisches Beispiel dafür ist Italien, wo Frauen nicht nur weniger arbeiten gehen, sondern auch weniger Kinder bekommen als beispielsweise im Nachbarland Frankreich. Die schwache Betreuungsinfrastruktur hat daran großen Anteil.
Susanne Strauß
Susanne Strauß erforscht Geschlechterungleichheiten in unbezahlten Tätigkeiten, sei es im Ehrenamt oder in Kinderbetreuung und Haushalt. Als Principal Investigator am Exzellenzcluster „The Politics of Inequality“ ist Susanne Strauß Mitinitiatorin eines Projekts zur Wahrnehmung von Gehaltsunterschieden aufgrund von Geschlecht und Dienstalter im Themenschwerpunkt „Die Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts“.
Der Vergleich mit anderen Ländern steht auch in Ihrer Forschung im Zentrum…
Ja, genau. In unserem Projekt zum „Produktiven Altern“ geht es darum, welche bezahlten und unbezahlten Tätigkeiten über 50jährige in verschiedenen Ländern übernehmen, also neben der Erwerbsarbeit auch informelle Pflege für Angehörige, ehrenamtliche Arbeit in Vereinen und Verbänden oder Enkelkinderbetreuung. Wir vergleichen das europaweit und untersuchen rund 20 Länder.
Was wären denn Entwicklungen, die in vielen Ländern parallel laufen?
Wir wissen, dass Frauen sich häufiger an informeller Pflege beteiligen, das ist länderübergreifend so. Das betrifft übrigens nicht nur die Kinderbetreuung, sondern auch die Pflege älterer Angehöriger, wobei das etwas weniger im Fokus der Diskussion ist.
Auch Personen, die sich dagegen entschieden haben, eigene Kinder zu bekommen, werden eventuell irgendwann unfreiwillig damit konfrontiert, dass sie pflegebedürftige Eltern oder Schwiegereltern haben. Hier sind Frauen stärker involviert als Männer. Etwas mehr sind Männer involviert, wenn es um pflegebedürftige Partnerinnen geht. Es scheint da eine gesellschaftliche Norm zu geben, dass der Partner die erste zuständige Person ist, sich um die Partnerpflege zu kümmern.
Die Nichtregierungsorganisation Oxfam beziffert in einer aktuellen Studie die Zahl der von Mädchen und Frauen geleisteten unbezahlten Haus-, Erziehungs- und Pflegearbeiten auf 12 Milliarden Stunden – und zwar pro Tag. Das entspricht einem globalen effektiven Verdienstausfall von rund 11 Billionen US-Dollar. Was fangen wir mit solchen Zahlen an?
Solche Berechnungen sind jetzt nicht ganz neu, die sind seit den 1970er Jahren fester Bestandteil der feministischen Kapitalismuskritik. Das Argument lautet: Unser kapitalistisches System funktioniert nur deshalb, weil im Hintergrund sozusagen eine Armee von Frauen die unbezahlten Tätigkeiten übernimmt. Die Umrechnung in einen Geld-Gegenwert scheint mir aber nicht so wichtig wie die Feststellung unbezahlt geleisteter Arbeitsstunden. Solche unbezahlten Aufgaben sind eine Zusatzbelastung, die Männer wie Frauen betrifft – Frauen aber eben mehr, da sie mehr Zeit in Haushalt, Erziehung und Pflege investieren. Das hat ja auch Zeitmangel für andere Tätigkeiten zur Folge.
Solche Zahlen sind aus wissenschaftlicher Sicht zwar nicht ganz unproblematisch. Sie zeigen aber eindrucksvoll, dass mehr unbezahlte Tätigkeiten von Frauen geleistet werden, und dass diese eine wichtige Voraussetzung dafür sind, dass Männer ihre Arbeitskraft dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen können.
Gibt es noch andere Ungleichheiten neben Geschlechterungleichheiten, die auf dem Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle spielen?
Mein Gebiet sind die Gender Studies, da schaue ich mir natürlich primär die Geschlechterungleichheiten an. Aber für mich ist es zentral, innerhalb der Geschlechter auch zu differenzieren.
Es gibt Frauen, die finanzielle und Bildungsressourcen haben und über Netzwerke verfügen, und die daher stärker von Angeboten des Wohlfahrtsstaats profitieren können. Beispiel Elterngeld: Während einige Frauen den Höchstsatz von 1800,- Euro bekommen, erhalten andere nur den Mindestsatz von 300,- Euro. Es ist klar, dass die einen stärker finanziell vom Partner abhängig sind als die anderen.
In den Gender Studies schaut man sich diese Verflechtungen von Geschlechts- mit anderen Merkmalen, sogenannte Intersektionen, genau an. Zum Beispiel untersucht man einmal die Situationen von Frauen mit hoher, einmal mit niedriger Bildung. Oder man analysiert die Wirkung bestimmter politischer Regelungen wie dem Elterngeld. Wir sehen uns an, wie Frauen mit hoher und Frauen mit geringer Bildung dastehen, Frauen, deren Eltern in Deutschland geboren sind, und solche mit Migrationshintergrund.
Ist es denn gerechtfertigt, dass andere Ungleichheiten in der öffentlichen Debatte weniger thematisiert werden als die Geschlechterfrage, etwa die Altersdiskriminierung?
Auch da möchte ich auf Verflechtungen hinweisen. Ältere Frauen zum Beispiel übernehmen mit zunehmendem Lebensalter tendenziell mehr Pflegeaufgaben, nicht nur für Kinder, sondern auch für Eltern oder sogar schon Partner. Dazu kommt noch, dass die gesellschaftliche Norm für Frauen über 50 nicht mehr so stark vorsieht, noch erwerbstätig zu sein, während das nach wie vor die Norm für Männer ist. Es wird eher erwartet, dass Frauen mehr unbezahlte Tätigkeiten übernehmen – mit allen Konsequenzen, die daran hängen, für ihre Alterssicherung und ihre finanzielle Unabhängigkeit zum Beispiel.
Es lohnt sich, auf die Zusammenhänge zu schauen, und den Faktor Geschlecht nicht isoliert zu betrachten. Am Equal Pay Day reden wir über eine bestimmte Prozentzahl, diese rund 20 Prozent, die Frauen weniger verdienen als Männer. Und zwar weil sie mehr in Teilzeit arbeiten, weil sie andere Berufe wählen als Männer, weil sie pro Stunde weniger verdienen. Aber man sollte auch die Unterschiede innerhalb der Frauen stärker diskutieren und in den Blick nehmen: Es gibt Frauengruppen, die bessere Chancen haben, und solche, bei denen das nicht der Fall ist. Und wir sollten untersuchen, wie verschiedene politische Entscheidungen sich auf unterschiedliche Gruppen von Frauen auswirken. Nur so können wir feststellen, bei welchen Gruppen die Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern besonders groß sind.