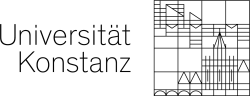Zufälle und das, was man aus Zufällen macht

Wie reifte in Ihnen der Entschluss, eine wissenschaftliche Laufbahn zu verfolgen?
Vom Land kommend habe ich mein Studium der Fächer Deutsch, Geschichte und Sozialkunde begonnen, ursprünglich mit dem Ziel, Lehrer zu werden. Während meiner Abschlussarbeit ist mir deutlich geworden, dass ich gerne weitermachen, promovieren würde. Dass sich dieser Entschluss dann auch verwirklichen ließ, verdanke ich großenteils auch Personen, die mich im rechten Moment unterstützt haben und Vertrauen in mich setzten. Beispielsweise, um die Finanzierung der Studienstiftung zu erlangen, mit der ich relativ bequem promovieren konnte.
Wegweisend war nach der Promotion für mich das Angebot, als wissenschaftlicher Mitarbeiter mit Hans-Ulrich Thamer von Erlangen nach Münster zu gehen. Als ich es annahm, war mir bewusst, dass es nun nicht mehr viele Alternativen für mich geben würde, als mich erfolgreich zu habilitieren und eine Professur anzustreben. Entsprechend habe ich mich angestrengt.
Und nach der Habilitation verbanden sich wieder glücklichen Konstellationen – wie der Fall der Mauer, der jungen Habilitanden wie mir Stellenperspektiven eröffnete, und Fürsprecher. So trat ich meine erste Professur in Halle an der Saale an, auf die recht bald der Ruf nach Konstanz folgte.
Haben Sie die wissenschaftliche Laufbahn jemals bereut?
Bereut habe ich es nie, aber ich erinnere mich auch an sehr sorgenvolle Phasen, in denen ich mir nicht sicher war, ob diese Laufbahn klappen würde. Beispielsweise musste ich mein ursprüngliches Habilitationsthema verwerfen. Das benötigte Archivmaterial, das angeblich zugänglich in der DDR lag, wollte man mir vor Ort doch nicht aushändigen. Damit war ein ganzes Jahr Arbeit in den Wind geschrieben und ich musste ein neues geeignetes Thema finden. Auch dass sich die Stellensuche von Kollegen in dieser Zeit schwierig gestaltete, belastete mich.
Das ist einer der Gründe dafür, dass ich mich für die Einrichtung von Juniorprofessuren mit Tenure Track einsetzte, als ich später in Konstanz die Möglichkeit hatte, etwas zu ändern. Nach wie vor finde ich, dass das Wissenschaftssystem ziemlich verschwenderisch und rücksichtslos mit Biografien des wissenschaftlichen Nachwuchses umgeht, auch wenn ich selbst nie Schaden erlitten habe.
In Ihrer Promotion beschäftigen Sie sich mit bäuerlicher Wirtschaft in der Frühen Neuzeit. Wie kamen Sie auf das Thema?
Mein Promotionsthema hat nichts mit meiner bäuerlichen Herkunft zu tun, sondern sollte, wie mein Doktorvater Michael Stürmer in Erlangen meinte, eine Erfolgsgeschichte staatlichen Handelns im 30-jährigen Krieg werden: ein paar Mandate lesen und daraus eine Doktorarbeit basteln. Ich saß also ein halbes Jahr im Hauptstaatsarchiv in München, las Mandate und hoffte, dass sich daraus schon etwas würde machen lassen – obwohl mir diese Herangehensweise persönlich nicht so lag.
Wie ging es dann weiter?
Eines Tages ging ich etwas frustriert ins Staatsarchiv gleich nebenan und fragte nach der Steuerbeschreibung von 1671, von der es in der Literatur immer hieß, es gäbe sie. Es gab sie tatsächlich. Ich sah mir die Quellen an und am Abend wusste ich, dass ich eine Promotion zu den sozialen Verhältnissen im Verlauf des 30-jährigen Krieges würde schreiben können. In der Steuerbeschreibung fanden sich sehr detaillierte Informationen zu einzelnen Bauernhöfen und ihrer wirtschaftlichen Situation. Eine phantastische Quelle also, um etwas über die Bauern und ihre Belastung durch Steuern und Abgaben gut zwei Jahrzehnte nach Kriegsende zu erfahren. Dies war tatsächlich so ein Moment, an dem ich das Gefühl hatte, mein Leben nimmt eine neue Wendung.
Was mir dabei sehr entgegenkam: Ich konnte gleichzeitig sozial-historisch empirisch arbeiten und meinen Anspruch verfolgen, mein Thema in die laufende Theoriediskussion zur Frühen Neuzeit einzubetten. Deshalb schrieb ich keine Arbeit über die Bauern, sondern über das Verhältnis von bäuerlicher Wirtschaft, Krieg und Staatsbildung. Der Staatsbildungsprozess fungierte als theoretischer Rahmen, der – wie ich meine – meine Arbeit auf eine andere Stufe hob.
Ihre geplante Habilitation über die „Freimaurerei“ scheiterte damals an der Zugänglichkeit der Quellen. Glaube und Religion zur Zeit der Säkularisierung scheint nicht die nächstliegende Alternative.
Meine Forschungsthemen ergaben sich meist aus einem Zusammenwirken von Zufällen und dem, was man aus Zufällen macht. Als ich ein alternatives Thema für die Habilitation suchte, stieß ich im Diözesanarchiv in Münster, im Stadtarchiv Köln und in der Aachener Dependance des Hauptstaatsarchivs Düsseldorf wieder auf Quellenmaterial, mit dem zu der Zeit in Deutschland noch niemand arbeitete: Testamente, Nachlassinventare von Geistlichen und Totenzettel. Das schienen mir aussichtsreiche Quellen, um etwas über die Veränderung religiöser Einstellungen und Praktiken im Übergang vom 18. aufs 19. Jahrhundert und damit über den langlaufenden Prozess der Säkularisierung zu erfahren.
© Universität Konstanz„Wenn man nach einem „roten Faden“ in meinen Forschungsarbeiten sucht, wäre er vielleicht das: nach Quellenbeständen zu suchen, die sich mit theoriegeleiteten Fragen erschließen lassen. “
Prof. a.D. Dr. Rudolf Schlögl
Wie gingen Sie dabei vor?
Natürlich kursierte das Stichwort Säkularisierung damals unter Historikern, aber weitgehend eben nur als ein Schlagwort, sodass ich erst bei Max Weber – leider vergeblich – nach einem passenden Begriffsinstrumentarium suchte, bevor ich Niklas Luhmanns Bändchen zur Religionssoziologie – Funktion der Religion – in die Hand bekam. Ein Lichtblick für mich! Da wurde eine Geschichte der Säkularisierung europäischer Gesellschaft erzählt und analytisch modelliert, mit der ich im Blick auf mein Material etwas anfangen konnte.
Die historische Aufschließung der Systemtheorie Luhmanns bekam irgendwann einen eigenständigen Projektcharakter für mich. Hier drehte sich das Verhältnis um, sodass ich fortan nach Themenfeldern und Quellen Ausschau hielt, mit denen sich das Anliegen, die vormodernde Gesellschaft systemtheoretisch zu denken, vorantreiben ließ: die Stadt, mit der ich mich in einem Drittmittelverbund an der Universität Konstanz beschäftigte, der Hof, und wieder die Religion.
An der Universität Konstanz setzen Sie sich als Sprecher des Exzellenzclusters „Kulturelle Grundlagen von Integration“ sehr engagiert für Verbundforschung ein. Was sind die Herausforderungen, was die Vorteile von Verbundforschung?
Als Exzellenzcluster erstmals ausgeschrieben waren, nahmen meine Kollegen und ich dies als Chance wahr, um strukturbildend in die Universität hineinzuwirken. Anfangs war dieser Auftrag mit der Exzellenzinitiative verbunden und uns war das auch sehr wichtig. Eine Reform von Promotionsstudiengängen, Professuren mit neuen Denominationen, Tenure-Track-Professuren, neue Studiengänge, neuartige Kollegstrukturen mit Fellowships und so weiter – was wir uns damals ausdachten und ausprobierten, fand glücklicherweise die Billigung und Unterstützung des Rektorats. Die Ideen flossen in die Universität ein und wurden zum Teil weiterentwickelt.
Wir haben dieses Exzellenzcluster benutzt, um die Universität zu dynamisieren. Dass wir durch die Clusterförderung die entsprechenden finanziellen Mittel hatten, machte uns so impulsfähig und wirkmächtig. Natürlich hatten wir Rechenschaft über die Verwendung der Gelder abzulegen, aber in der Sache waren wir weitgehend frei.
Gratulation zur Bewilligung des Exzellenzclusters "Kulturelle Grundlagen von Integration"
Und die Herausforderungen?
In den nächsten Ausschreibungsrunden, gestärkt insbesondere auch durch die dritte Förderlinie, wurde die Exzellenzinitiative zu einem Instrument der Steuerung und Gestaltung der Universität durch die Rektorate. Damit ist leider ein großer Teil der strukturellen Innovationskraft, die anfangs mit dieser Initiative verbunden war, verloren gegangen. Geblieben ist eine strukturelle „Überproduktion“ von Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern, ohne dass das System sich politisch und institutionell darauf eingestellt hätte, wie man damit umgeht.
Was könnte hier anders gemacht werden?
Ein anderer Umgang mit Biografien würde bedeuten, dass Universitäten befristete Stellen in Dauerstellen umbauen müssten. Und ohne dass man die Qualitätskontrolle außer Acht lässt, müsste zu einem früheren Zeitpunkt eine Entscheidung darüber getroffen werden, ob jemand im Wissenschaftssystem erfolgreich seinen Platz finden kann oder nicht. In diesem Zusammenhang wäre noch einmal ganz gezielt über Frauenförderung nachzudenken. Denn die Perspektive von Frauen stellt sich gerade in dieser Lebensphase, in der man sich für oder gegen eine wissenschaftliche Karriere entscheidet, anders dar als für Männer.
Welchen Forschungen werden Sie künftig nachgehen?
Mein aktuelles wissenschaftliches Projekt ist die Summe dessen, was ich die letzten Jahrzehnte wissenschaftlich betrieben habe: Ich möchte eine systemtheoretisch gearbeitete Gesellschaftsgeschichte der Frühen Neuzeit in Europa schreiben. Zu zwei Dritteln bin ich mit diesem Projekt, das eine gewisse Eigendynamik entwickelt hat, durch.
Bislang kann ich mir ein Leben ohne Schreibtisch nicht vorstellen. Doch gleichzeitig bin ich froh, dass ich nicht mehr – wie es lange der Fall war – jede Minute, die ich nicht am Schreibtisch verbringe, als verschwendete Zeit betrachte. So werde ich meine Forschung auf „Teilzeit“ zurückschrauben und dafür das Familienleben intensivieren. Neben dem Radsport, den ich schon viele Jahre betreibe, lerne ich gerade noch einen zweiten Sport, nämlich Rudern. Das macht mir großen Spaß und ich bin auch in der Vereinsarbeit aktiv, was in der sozial „dürren“ Coronazeit, doch ein wenig an gelebter Sozialität zuließ.
Auf wissenschaftlicher Ebene möchte ich den Kontakt zur Universität Konstanz weiterhin pflegen, beispielsweise als Mitglied des Zentrums für Kulturwissenschaftliche Forschung (ZKF), der Nachfolgeinstitution unseres Clusters.
Das Gespräch führte Claudia Marion Voigtmann.
Link zur Abschiedsvorlesung am 12. Juli 2022: https://streaming.uni-konstanz.de/talks-und-events/2022/abschied-schloegl/