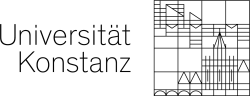Integration: erforschen und vermitteln

Von dem Transferprojekt „Fortbildungsprogramm für Integrationsbeauftragte“ erfährt die Kulturanthropologin Kathrin Leipold über eine Stellenausschreibung – eine Anzeige, die sie zunächst löscht, obwohl sie aufgrund ihrer Qualifikationen sehr gut passen würde. „Integration als Begriff erschien mir ein veraltetes Konzept zu sein“, meint heute die Wissenschaftlerin schmunzelnd. „Am nächsten Tag habe ich die Anzeige wieder aus dem virtuellen Papierkorb hervorgeholt, weil sie mich doch nicht mehr losgelassen hat.“ Insbesondere, dass es sich um ein Transferprojekt handelt, findet sie sehr reizvoll. Sie bewirbt sich und bekommt den Zuschlag.
Viele Hüte, ein Gesicht
Gleich bei ihrem Projekt-Einstieg im Juni 2021 bemerkt Leipold, wie dringend dieses Fortbildungsprogramm vonseiten der Praxis gewünscht wird. Denn die meisten Integrationsbeauftragten steigen in das hochbrisante politische Feld quer ein. „Sie bekommen gleichzeitig viele Hüte aufgesetzt. Das heißt, sie müssen die Verwaltung bedienen können und verschiedene Abläufe kennen – beispielsweise wissen, wie man sich gut im Gemeinderat mit den jeweiligen Ergebnissen präsentiert“, erklärt Leipold. „Gleichzeitig müssen sie aber auch über alle inhaltlichen Fragen Bescheid wissen.“
Das Thema reicht in viele Diskurse hinein, globale Prozesse wie den Klimawandel, das Nord-Süd-Gefälle, und viele mehr. „Es ist eine unglaubliche Vielzahl an Aufgaben und Wissensbereichen, die Integrationsbeauftragte kennen müssen“, fasst die Wissenschaftlerin zusammen. Ein Fortbildungskonzept zu entwickeln, das vielseitig und wissenschaftlich fundiert ist, war Ziel des Transferprojekts des FGZ Konstanz. Dazu Leipold: „Sich als Integrationsbeauftragte alleine durchzuschlagen, ist sehr schwierig. Sie sind oft EinzelkämpferInnen und das versuche ich, mit diesem Fortbildungsprogramm zu ändern.“
© Kathrin LeipoldTransfer ist Austausch auf Augenhöhe. Die Impulse der Integrationsbeauftragten fließen in das Fortbildungskonzept ein.
Hürden zu Projektbeginn
Als Leipold das Projekt übernimmt, liegt es seit Monaten brach, weil ihr Vorgänger eine andere wissenschaftliche Position angetreten hat. „Wegen dieser mehrmonatigen Vakanz in der Stelle hatten meine PraxispartnerInnen den Eindruck, das Projekt würde stocken. Es war extrem schwierig, aus diesem ‚Motivations-Loch‘ herauszukommen und mich mit meinen Ideen ins Spiel zu bringen“, erzählt die Kulturanthropologin. „Ich hatte aber das große Glück, Stefan Schlagowsky-Molkenthin von der Stabstelle Integration in Singen kennen zu lernen. Er hat nicht nur die Brisanz verstanden, die sich aus der zeitlichen Verzögerung ergab. Sondern er hat mich auch offen und engagiert mit den anderen ins Gespräch gebracht.“
Eine gemeinsame Sprache zu finden, empfand Leipold als weitere Herausforderung: „Wissenschaft ist eine andere Welt als die der Verwaltung. Und sich da mittels Transfer an die Praxis heranzuwagen, ist schon auch ein Experiment“, meint sie. Auf der anderen Seite stehe die Welt der Verwaltung mit ihren vielen Regelungen, Prozedere, Hierarchien. Und politisch sehr brisante Bereiche wie eben der Integrationsbereich glichen sogenannten black boxes, sie blieben den WissenschaftlerInnen oft vorenthalten. Aber Leipold lässt sich auf die Annäherung zwischen Wissenschaft und Praxis ein, und es gelingt ihr allmählich, ihr Projekt bekannt zu machen.
Raum für Austausch
Wenn man als WissenschaftlerIn regelmäßig über die eigenen Ergebnisse informiere, reiche das nicht aus. Ebenfalls eine neue Erfahrung für Leipold aus dem Transferprojekt. „Es braucht Raum für Austausch, um diesen Raum zwischen Wissenschaft und Verwaltung zu gestalten und zu leben. Und hier Transferwissen gemeinsam hervorzubringen. Denn nur Wissen aus der Wissenschaft oder nur Wissen aus der Praxis stehen wie Pole nebeneinander. Wir brauchen den dritten Raum des Austausches, damit das Transferprojekt glückt.“

„Ich verstehe Transfer – und so lebe ich das auch in meinem Projekt – als ganz intensive Zusammenarbeit mit PraxispartnerInnen. Mir ging es nicht um eine eindimensionale Weitergabe von wissenschaftlichen Kenntnissen an gesellschaftliche AkteurInnen oder umgekehrt von Praxiswissen an die Wissenschaft, sondern um Dialog – in meinem Fall zwischen IntegrationsakteurInnen und Wissenschaft.“
Kathrin Leipold
Wie ein Fortbildungsprogramm aussehen muss, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen, erarbeitet die Wissenschaftlerin entsprechend mit den Integrationsbeauftragten gemeinsam. „Sie haben mir die Impulse gegeben, die ich dann in das Fortbildungsprogramm zu übersetzen versuchte. In engem Austausch haben wir vier Bedarfsfelder ermittelt“, sagt Leipold. „Das begann mit der vielleicht banal klingenden Frage: Was ist eigentlich der Auftrag von Integrationsbeauftragten? Eine Antwort darauf zusammen herauszuarbeiten – von Bundes- über Landesebene bis hin zur kommunalen Ebene heruntergebrochen –, diese Praxisnähe bietet bislang kein anderes Ausbildungsangebot.“
Von der Bedarfsanalyse zur Konzeption
Das Programm vermittelt Fach- und Methodenkompetenz in den diversen Handlungsfeldern von Integrationsbeauftragten: Dazu gehören unter anderem Bildung, Frauenförderung, interreligiöser Dialog, Freizeitgestaltung, inklusive Sportangebote und Wohnungspolitik. Außerdem wünschten sich die Integrationsbeauftragten, Anschluss an die Diskurse zu Integration zu erhalten; beispielsweise „Postmigration – was heißt das eigentlich? Muss ich damit arbeiten können?“ Als weiterer Bedarf kommen Fragen der Selbstverwaltung hinzu: Wie kann ich mich als Integrationsbeauftragte organisieren?
Das Fortbildungsprogramm hat sich mittlerweile herumgesprochen – in ganz Baden-Württemberg. Leipold führt eine Warteliste von InteressentInnen. Beliebt sind Formate, die Austausch fördern, wie beispielsweise MittagsMeetingsIntegration (MMI): „Einmal im Monat lade ich die Integrationsbeauftragten der Städte, Gemeinden und Landkreise in einen Zoomraum ein. Und jeder, der Zeit und Lust hat, schaut dort vorbei. Jedes Mal treffen sich zwischen 40 und 50 Personen virtuell, was angesichts von 220 vom Land geförderten IBs zeigt, wie gut das Angebot angenommen wird. Wir sprechen dort über aktuelle Themen und diskutieren über Probleme aus der Praxis.“
Wie geht es weiter?
Die Konzeptionsphase des Fortbildungsprogramms ist seit Mai 2024 abgeschlossen. Doch wie können diese Strukturen weitergereicht werden und an wen? Wie sieht eine nachhaltige Finanzierung aus? Welche Form von Zertifizierung braucht man? „Dies sind Fragen, die man sich als Wissenschaftlerin ja niemals stellen würde“, sagt Leipold, „und an diesem Punkt bin ich jetzt.“
Keine gesetzliche Pflicht schreibt Integrationsbeauftragten vor, Weiterbildungen zu machen, das ist laut Leipold schon der erste Teil des Problems. Gesetzliche Grundlage für deren Arbeit ist die Verwaltungsvorschrift Integrationsbeauftragte, die es seit 2013 und deutschlandweit nur in Baden-Württemberg gibt, die jedoch keine Fortbildungen zur Pflicht macht. „Ich betone in Gesprächen mit den Verantwortlichen stets, dass diese Weiterbildungspflicht in der Novellierung der Verwaltungsvorschrift eingeschrieben werden sollte, und hoffe, dass dies auch geschieht“, betont die Wissenschaftlerin.
Insgesamt hält sie über einen Think Tank engen Kontakt zu den VertreterInnen aus den kommunalen Landesverbänden in Baden-Württemberg, zum Ministerium in Stuttgart und zu wichtigen AkteurInnen in der Integrationsarbeit. Dieser Think Tank soll die Verstetigung des Programms auf den Weg bringen. In der neu bewilligten Projektphase bis 2029 wird es darum gehen, eine Plattform aufzubauen, auf der sowohl das Fortbildungsprogramm als auch ein noch zu entwickelndes Portal sichtbar wird: „IntegrationsakteurInnen stärken und vernetzen“. Neben Fragen nach Austausch sind es aber auch Fragen nach aktiver Diskursgestaltung, die bearbeitet werden wollen. Für die Plattform heißt dies, neben den zwei Säulen „Weiterbildung“ und „Netzwerk“ auch im Bereich „Aktive Diskursgestaltung“ zu arbeiten und hier Veranstaltungsreihen oder Konferenzen zu integrationspolitischen Themen anzubieten.