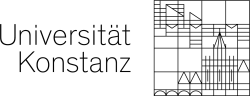Interview: Dr. Marcus Twellmann
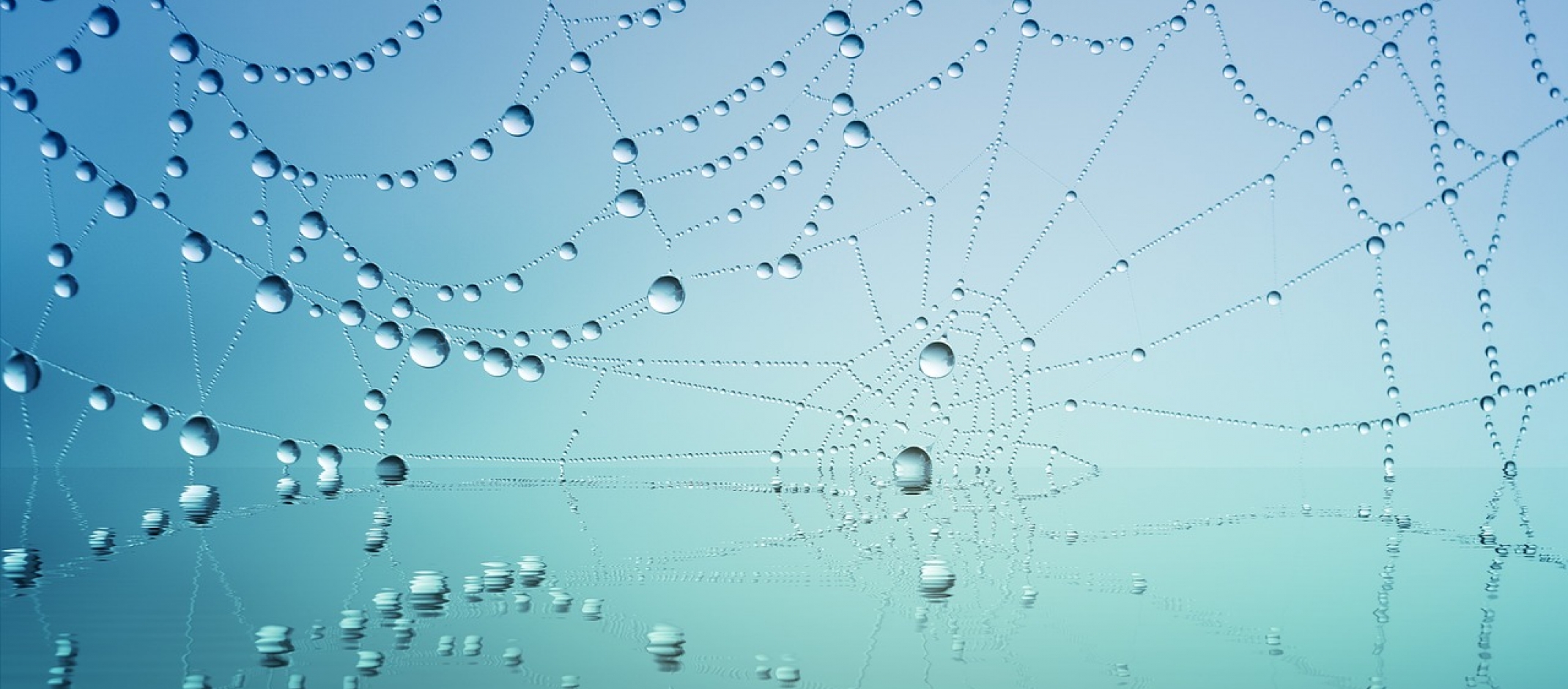
Herr Dr. Twellmann, zählen Sie sich zu den wissenden oder den nicht wissenden Wissenschaftlern?
Wie jeder andere Wissenschaftler muss ich auf diese Frage eigentlich eine doppelte Antwort geben: „weder noch“ und „sowohl als auch“. Das liegt auf der Hand: Wenn wir nicht auch nicht-wissend wären, dann wäre die Wissenschaft am Ende. Solange wir nicht allwissend sind, besteht ein Anlass zu weiterer Forschung. Dabei ist es hilfreich, das eigene Nicht-Wissen zu spezifizieren. Man weiß, dass man etwas nicht weiß, und bestimmt dieses Nicht-Wissen mit Bezug auf das vorhandene Wissen, um es durch weitere Forschung zu überwinden. Diese Art des Umgangs mit einem Noch-Nicht-Wissen bereitet eigentlich keine besonderen Probleme. So funktioniert Wissenschaft im Normalbetrieb.
Wir leben in einer Wissensgesellschaft. Sie wollen das Nicht-Wissen erforschen. Warum?
Weil unsere Wissensgesellschaft, das wird zunehmend deutlich, zugleich eine Nicht-Wissensgesellschaft ist. Die Rede von der „Wissensgesellschaft“ behauptet ja, das Wissen sei unsere wichtigste Ressource. Die Vermehrung des Wissens ist unter anderem mit der Aussicht auf technische Sachbeherrschung verbunden. Ich habe zum Beispiel einen Kühlschrank, Sie vermutlich auch. Dass man Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe industriell herstellen und als Kühlmittel einsetzen kann, ist für uns nichts Besonderes mehr und gehört fast schon der Vergangenheit an. In den 1930er Jahren war das eine große Sache. Es hat dann ein halbes Jahrhundert gedauert, bis das Ozonloch entdeckt wurde.
Dass FCKW die Ozonschicht schädigt, hat man während dieser Zeit nicht gewusst, ja nicht einmal geahnt. Offenbar wurde hier im Zuge der Wissenserzeugung auch das Nicht-Wissen vermehrt. Und zwar ein Nicht-Wissen, von dem man nichts wusste. Darum konnte es zunächst auch nicht spezifiziert und durch weitere Forschung überwunden werden. Aus diesem Fall ist zu lernen, dass wir offenbar von einer Dynamik der wechselseitigen Steigerung von Wissen und Nicht-Wissen ausgehen müssen. Darauf zielt zunächst einmal die Rede von der „Nicht-Wissensgesellschaft“. Vielleicht leben wir aber auch in einer Gesellschaft, in der das Nicht-Wissen eine Aufwertung erfährt.
Sind Sie ein neugieriger Mensch?
Ich bekenne meine Schuld.
Wie meinen Sie das?
Historisch gesehen ist die Neuzeit beherrscht von einem Willen zum Wissen. Dass Wissen gegenüber Nicht-Wissen zu bevorzugen ist, scheint uns selbstverständlich und geradezu natürlich. Das war nicht immer so und muss nicht so bleiben. Eine Aufwertung des Nicht-Wissens lässt sich in vielen Praxiszusammenhängen beobachten, zum Beispiel am Umgang mit persönlichen Daten. Seit 1983 gibt es in Deutschland ein anerkanntes „Recht auf informationelle Selbstbestimmung“. Jeder Einzelne hat das Recht, über die Erhebung, Weitergabe und Verwendung seiner Daten selbst zu bestimmen. Er hat somit auch das Recht, Dritten ein Wissen von seiner Person vorzuenthalten. Neuerdings ist darüber hinaus von einem „Recht auf Nicht-Wissen“ die Rede: Nicht nur die Offenbarung von Daten gegenüber Dritten, sondern auch dem Einzelnen selbst gegenüber soll unter rechtlichen Schutz gestellt werden. Das wird vor allem im Zusammenhang der Genomanalyse diskutiert.
Lange Zeit ging man im Bereich der genetischen Beratung davon aus, dass mehr Wissen immer gut ist. Heute ist man da vorsichtiger. Keinem Patienten dürfen unaufgefordert Informationen aufgezwungen werden. Auch in ganz anderen Lebensbereichen wurde der Wert des „Nicht-Wissens“ erkannt. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat ein Soziologe darauf hingewiesen, dass Beziehungen zwischen Menschen nicht nur ein gewisses Maß an Wissen des einen vom andern erfordern, sondern auch ein gewisses Maß an gegenseitiger Verborgenheit. Das gilt nicht zuletzt für Paarbeziehungen. Wir sollten unserem Partner auf keinen Fall alles über uns verraten – das Geheimnis erhält eine Beziehung am Leben!
Warum sind Sie Wissenschaftler geworden?
Mein Vorvater biss in einen Apfel. Das Weitere ist bekannt.
Wie definieren Sie Wissen, wie Nicht-Wissen?
Nicht-Wissen ist ja ein Negationsbegriff. Man muss also vom Wissen ausgehen. Aber auch das ist nicht leicht zu definieren. Den Philosophen ist ein idealisierter Begriff des Wissens vertraut. Sie verstehen Wissen als überzeitlich wahre Überzeugung. Als Kulturwissenschaftler interessiere ich mich eher dafür, was in einer Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit als Wissen gilt. Wir gehen davon aus, dass Wissen kulturell „situiert“ ist und beschreiben unterschiedliche „Geltungskulturen“. Dabei ist eine Gleichsetzung von Wissen und Wahrheit zu vermeiden.
Wieso?
Man kann dann auch Nicht-Wissen und Irrtum unterscheiden. Das ermöglicht eine Beobachtung anderer Kulturen und Epochen auf Augenhöhe. Anderen, die sich aus unserer Sicht im Irrtum befinden, weil sie zum Beispiel glauben, in den Eingeweiden eines Tieres stehe die Zukunft, kann dann zugestanden werden, dass sie durchaus über ein Wissen verfügen, das sie für wahr und begründet halten. Auch die Halbwertzeit unserer eigenen Wissensbestände und -praktiken schätzen wir ja zunehmend vorsichtig ein. Heute glauben wir noch, die Entwicklung eines Wertpapiers aufgrund einer grafischen Darstellung des Kursverlaufs voraussagen zu können, morgen schütteln wir darüber vielleicht schon den Kopf. Ich würde Nicht-Wissen also nicht etwa als Pseudo-Wissen definieren, sondern als Abwesenheit von Wissensansprüchen und Erwartungen jeder Art.
Wessen Wissen bewundern Sie?
Das Wissen derer, die auch nicht wissen können.
Werden Sie am Ende Ihres Projekts die Begriffe „Wissen“ und „Nicht-Wissen“ unter Umständen neu definieren müssen?
Bei ungewolltem und nicht gewusstem Nicht-Wissen kommt man mit dieser Definition ganz gut zurecht. Schwierig wird es, das ist schon jetzt klar, bei gewolltem Nicht-Wissen, ich könnte auch sagen: Ignoranz. Wenn Sie zum Beispiel das Ergebnis einer Gesundheitsuntersuchung nicht wissen wollen, weil ihre Zukunft offen bleiben soll, dann wissen sie immerhin ungefähr, was sie nicht wissen wollen. Das gilt nicht nur für Personen, sondern auch für Organisationen. Denken Sie an die Katholische Kirche und ihren Umgang mit Fällen von Kindesmisshandlung. Organisationstheoretisch stellt sich übrigens auch eine Frage, die vielleicht zynisch wirkt, weil sie moralische Normen zunächst vernachlässigt. Wir können auch fragen, ob Nicht-Wissen funktional ist, insofern es eine Organisation stabilisiert. Die Frage stellt sich auch mit Blick auf ganze Gesellschaften, die etwa nach Phasen der Gewaltherrschaft davon nichts mehr oder zumindest vieles nicht ganz so genau wissen wollen.
Wie gehen Sie bei Ihrem Projekt vor?
Wie immer: Ich sitze an einem Tisch, lese, was andere geschrieben haben, mache mir dazu eigene Gedanken und schreibe die wieder auf. Dann treffe ich wieder Kollegen, um Gespräche zu führen. Als wissenschaftlicher Koordinator betreue ich das Thema „Nicht-Wissen“ im Rahmen des Konstanzer Exzellenzclusters. „Nicht-Wissen“ ist das derzeitige aktuelle Thema des Kulturwissenschaftlichen Kollegs. Dort arbeiten Konstanzer Kolleginnen und Kollegen mit Gästen zusammen, die für ein Jahr von ihren Universitäten freigestellt wurden, um sich in Konstanz ganz auf ihre Forschung zu konzentrieren.
Bitte ergänzen Sie die beiden nachfolgenden Sätze:
- Wissen macht... nicht glücklich. - Nicht-Wissen macht... vielleicht glücklich.
In welchen Fachbereichen wollen Sie Ihre Untersuchungen anstellen?
Die beteiligten Wissenschaftler kommen aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen: Rechtswissenschaft und Anthropologie, Soziologie, Politologie, Literaturwissenschaft und Ökonomie. Da kommen natürlich ganz unterschiedliche Sichtweisen zusammen – das macht die Sache spannend. In ökonomischer Hinsicht ist das Nicht-Wissen zum Beispiel eine Ressource: Nur weil wir die Zukunft nicht kennen, können wir sie bewirtschaften. Die einen machen mit Risikogeschäften Gewinne, die anderen Verluste. Dabei spielt auch die ungleiche Verteilung von Wissen eine Rolle, etwa zwischen Anlageberatern und Bankkunden. Für die Juristen können sich daraus Fragen der rechtlichen Haftung ergeben: Mal angenommen, Ihre Bank hat Ihnen zu Lehmann-Papieren geraten – können sie nach deren Entwertung ihren Berater für den eigenen Verlust haftbar machen? Ähnliche Fragen stellen sich im Zusammenhang mit ungewollten Technikfolgen.
Wer werden Ihre Probanden sein?
Kulturwissenschaftler stellen kaum Versuche an und machen auch selten Umfragen. Wir analysieren fast ausschließlich Texte, manchmal auch Bilder oder andere Artefakte. Da ich eigentlich Literaturwissenschaftler bin, habe ich es vor allem mit „Literatur“ im weitesten Sinne des buchstabenschriftlich Verfassten zu tun. Ich interessiere mich aber auch für andere Zeichenarten und Darstellungsformen, zum Bespiel für Zahlen und Tabellen. Zurzeit beschäftige ich mich mit der Geschichte der „Statistik“. Heute denkt man dabei gleich an die Erzeugung und mathematische Verarbeitung numerischer Daten. Das war nicht immer so. Im 18. Jahrhundert bediente die „Statistik“ oder „Staatskunde“ sich vor allem deskriptiver Darstellungsmittel.
Welche Wissensfrage hätten Sie gerne beantwortet?
Wie wird man Wissensfragen los?
Es sollte der Zustand eines Staates beschrieben werden. Erst nach der Wende zum 19. Jahrhundert gewann die tabellarische Darstellung von Zahlen an Bedeutung. Damals brach ein Streit aus, der so genannte „Statistiker-Streit“. Diese „epistemische Konfliktsituation“ – so nenne ich das – ist für mich interessant, weil sie das Nicht-Wissen der Zahlen- und Tabellenstatistik hervortreten ließ. Die Gegner dieser neuen Wissenspraxis hatten im Blick, dass sie auch ein neuartiges Nicht-Wissen erzeugte. Bestimmte Gegebenheiten, so lautete ihr Argument, sind quantitativ nicht erfassbar. Man kann sie nur beschreiben. Das war kein rein wissenschaftlicher Streitpunkt. Aufgabe der Statistik war die Erzeugung von Regierungswissen. Sie stellte die Grundlage für Verwaltungsmaßnahmen und Gesetzgebungsakte bereit. Mit der Ersetzung von Beschreibungen durch Tabellen war somit ein Nicht-Wissen der Regierung verbunden, das natürlich Folgen hatte für die Gesellschaft. Daraus ist nicht etwa zu schließen, dass es in jedem Falle besser ist, die Welt zu beschreiben als sie zahlenmäßig zu erfassen – obwohl ich als Literaturwissenschaftler natürlich voreingenommen bin für Buchstaben. Eher kann man daran ersehen, dass jede Wissensform eine dunkle Außenseite hat. Und die Frage ist: Wie sollen wir mit diesem unvermeidlichen Nicht-Wissen umgehen?
Lexikon
Das Kulturwissenschaftliche Kolleg ist eine der tragenden institutionellen Säulen des Exzellenzclusters „Kulturelle Grundlagen von Integration“. Mit ihm werden Freiräume geschaffen, in denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unkonventionelle Fragen entwickeln und entfalten können. Ziel des Kollegs ist es, seinen Fellows für einen begrenzten Zeitraum − in der Regel ein akademisches Jahr − die grundsätzliche Befreiung von Lehre und Gremienarbeit zu ermöglichen, um sich ausschließlich der Forschung widmen zu können.
Jährlich werden rund 20 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an das Kulturwissenschaftliche Kolleg Konstanz eingeladen, um ihre Forschungsarbeiten dort fortzuführen und/oder zu Ende zu bringen. Jeweils die Hälfte der Eingeladenen kommt aus Konstanz und aus aller Welt. Einladungen werden auf Vorschlag von Clusterangehörigen ausgesprochen. Außerdem werden jährlich Stipendien ausgeschrieben, auf die sich entsprechend qualifizierte Post-docs bewerben können.
Sitz des Kollegs ist die Bischofsvilla am Konstanzer Seerhein mit Außenstelle Seeburg im benachbarten schweizerischen Kreuzlingen.
Stoßen Sie bei Ihrem Projekt schon jetzt an Grenzen?
Allerdings! Eigentlich können wir die Grenze zum Nicht-Wissen mit wissenschaftlichen Mitteln nicht überwinden. Wer sich für das Nicht-Wissen interessiert, nähert sich fast unvermeidlich der Religion.
Wer forscht, vor dem tun sich immer mehr Fragen auf. Das war wohl auch früher so. Hatten die Menschen in früheren Zeiten diese Erkenntnis, und wenn ja, wie sind sie damit umgegangen?
Ich habe von spätmittelalterlichen Theologen gehört, die bei der Gotteserkenntnis mit wissenschaftlichen Mitteln nicht weiter gekommen sind. Durch die Belehrung über seine Unwissenheit vermag der menschliche Geist angeblich, sich selbst zu transzendieren.
Marcus Twellmann...
1972 in Westfalen geboren und aufgewachsen, studierte Literaturwissenschaft und Soziologie in Bielefeld, Paris, New York und Berlin. 2003 wurde er in Frankfurt/Oder mit einer Arbeit über „Das Drama der Souveränität. Hugo von Hofmannsthal und Carl Schmitt“ promoviert. Nach einer Gastprofessur an der Johns Hopkins University in Baltimore habilitierte er sich 2009 an der Universität Bonn mit einer Arbeit, die inzwischen bei Konstanz University Press erschienen ist: „‚Ueber die Eide‘. Zucht und Kritik im Preußen der Aufklärung“. Seit 2009 koordiniert er an der Universität Konstanz die Forschungsstelle „Kulturtheorie und Theorie des politischen Imaginären“. Zurzeit betreut er im Rahmen des Konstanzer Exzellenzclusters „Kulturelle Grundlagen von Integration“ den Forschungsschwerpunkt „Nicht-Wissen“.