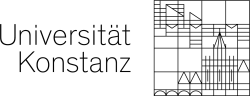Wenn das eigene Leben Forschungsfragen stellt

Zu Ihrem beruflichen Profil: Sie sind Professorin am Lehrstuhl für angewandte Mikroökonomie. Woher kommt die Faszination für Ihr Fachgebiet?
Christina Felfe: Während meiner Promotion über „Female Labour Supply“, habe ich mich mit der Frage beschäftigt, warum Frauen weniger Geld verdienen als Männer. Ich bin dann sehr schnell darauf gekommen, dass es nicht grundsätzlich Frauen sind, die weniger verdienen, sondern vor allem Mütter. Anfangs war mir gar nicht klar, dass ich für meine Dissertation die Mikroökonomie und vor allem die Ökonometrie brauchen würde, ich bin da damals so ein bisschen naiv reingestolpert. Aber ich benötigte eine Theorie, dazu die Statistik, hatte große Datensätze – alles Dinge, die man mit dem Know-how der Mikroökonomie und der Ökonometrie bearbeiten kann.
Ich bin also eigentlich auf die Mikroökonomie gekommen, weil mich diese gesellschaftlichen Fragen wie der Gender Pay Gap oder eine bessere Integration von Kindern mit Migrationshintergrund interessieren. Ich bin der Überzeugung, dass sich diese Fragen nur beantworten lassen, wenn ich eine Theorie habe, die aus der Mikroperspektive kommt, also vom Individuum her. Die Ökonometrie ist dann das Mittel zum Zweck.
Sie haben neulich untersucht, wie sich die Auswirkungen der Schulschließungen während der Coronapandemie auf die psychische Gesundheit von Jugendlichen ausgewirkt hat. Wie kamen Sie auf dieses Thema?
Meine Doktormutter hat immer gesagt, ihre Forschung sei stets durch ihre persönlichen Lebensumstände geprägt. Meine Lebensumstände haben sich im März 2020, wie die von vielen Menschen, radikal verändert. Ich hatte auf einmal drei Kinder zu Hause und das ganze Netzwerk an formeller und informeller Kinderbetreuung, das wir uns vorher mühevoll aufgebaut hatten, ist von heute auf morgen zusammengebrochen. Es wurde aber trotzdem erwartet, dass man im Vorlesungssaal oder in meinem Fall im virtuellen Vorlesungsraum steht, in Vollzeit berufstätig ist, die Kinderbetreuung und das Homeschooling gewährleistet – und das ging einfach nicht. Ich bin absolut an meine Grenzen gekommen und konnte anfänglich kaum eine Nacht mehr schlafen.
Ich konnte nicht schlafen, weil ich einfach so empört und entrüstet war, wie da mit Menschen umgegangen wurde, unter anderem mit Argumenten, die nicht stichhaltig waren. Natürlich habe ich dieses Unwissen zu Beginn der Pandemie gesehen und verstanden. Aber gerade Kinder, Jugendliche und Familien waren die Teile der Gesellschaft, die als erstes betroffen waren und die letzten, die wieder zurück in ein normales Leben konnten. Ich habe viele schlaflose Nächte mit dem Versuch verbracht, die Persönlichkeiten der PolitikerInnen, die diese Entscheidungen getroffen haben, zu verstehen.

„ Irgendwann habe ich mir gesagt, vielleicht muss ich diese destruktive Energie in eine konstruktive Energie umwandeln und Forschung dazu betreiben.“
Christina Felfe de Ormeño
Die Ergebnisse der Studie waren ziemlich drastisch und haben ein großes mediales Echo gefunden. Provokativ gefragt: Warum braucht es bei diesem Thema eine sozialwissenschaftliche Perspektive?
Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir keine Forschung zur Pandemie selbst machen. Wir sind keine EpidemiologInnen und wollen nichts machen, wo wir nicht auch kausale Wirkungszusammenhänge der Politikmaßnahmen beschreiben können. Aber die Maßnahmen, die aufgrund der Pandemie ergriffen wurden, haben eben nicht nur medizinische oder wirtschaftliche, sondern auch soziale, bildungspolitische und verhaltensbezogene Konsequenzen. Und da denke ich, können wir als SozialwissenschaftlerInnen einen wichtigen Beitrag leisten. Wir wollten uns ganz konkret die unerwünschten Auswirkungen von Politikmaßnahmen anschauen, und da haben sich die Schulschließungen angeboten. Alle Bundesländer haben schnell die Schulen geschlossen, die Öffnungsstrategien waren aber sehr unterschiedlich. Je nach Jahrgangsstufe, Schultyp und Bundesland sind Kinder und Jugendliche zu komplett verschiedenen Zeitpunkten in die Schule zurückgekehrt. Dadurch konnten wir die Auswirkungen dieser Politikmaßnahme sehr gut vergleichen und uns das Wohlergehen, die seelische Gesundheit der Jugendlichen anschauen.
Die Daten hatten KollegInnen aus der Kinderpsychologie bereits gesammelt, wir haben dann das statistische Know-how dazu beigesteuert, sodass wir diese Daten den spezifischen Maßnahmen zuordnen konnten. Das war genau das, worauf ich schlussendlich mit der Studie hinauswollte:
„Sollten wir jemals wieder in so eine Situation kommen, sollten wir auch aus der Vergangenheit gelernt haben und neben allem Nutzen der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie auch deren Schaden mit in Betracht ziehen. Als SozialwissenschaftlerInnen können wir zwar keine Pandemien im Schach halten, aber wir können uns evidenzbasierte wissenschaftliche Empfehlungen für die Maßnahmen, die dann ergriffen wurden, herausnehmen.“
Christina Felfe de Ormeño
Welche Rolle spielt der Exzellenzcluster in Ihrer Forschung und welche Vorteile ziehen Sie daraus?
Der Cluster ist für mich in dem Sinn einmalig, um Kontakte zu und Expertise aus anderen Disziplinen zu bekommen. In meiner eigenen Disziplin habe ich diese Kontakte natürlich, aber interdisziplinär liegt das nicht immer so auf der Hand. Der Cluster bietet mir die Möglichkeit, meine Forschungsthemen aus interdisziplinärer Perspektive zu bearbeiten. Ich habe auch das Gefühl, dass meine Forschung am Cluster auf großes Interesse stößt und ich viel Unterstützung für meine Projekte bekomme. Dadurch bietet sich mir die Chance, immer wieder Themen aufzugreifen, die nicht unbedingt das Kernthema meiner eigenen Forschung sind.
Ihre KollegInnen und Studierende werden dieses Interview lesen. Was möchten Sie ihnen von Ihrem Weg mitgeben?
Mein Weg war nie gradlinig, aber letztendlich war es immer meiner. Interessant ist: Wenn ich jetzt so rückblickend schaue, ergibt das alles Sinn und jeder Teil war wichtig für sich. Aber es gab viele Hürden zwischendurch, viele Umwege, viele Stolpersteine. Jetzt bin ich da, wo ich mich wirklich wohlfühle und wo ich das Gefühl habe, ich kann viel von meinen KollegInnen und den Personen an der Universität Konstanz lernen und mitnehmen. Gleichzeitig hoffe ich aber auch selbst einiges beitragen zu können, ich denke, dass es ein sehr guter Fit ist.
Der Text ist ein Auszug aus einem Interview mit der Wissenschaftlerin, das in voller Länge erstmals im In_equality magazin No. 6: „(Un)gleiche Chancen“ des Exzellenzclusters „The Politics of Inequality“ erschienen ist.
Das Interview führte Annalena Kampermann.
Copyright Porträt: Ines Janas