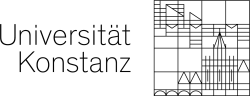Wissenschaftsethik in der Konflikt- und Entwicklungsforschung

Die Geburt der ersten genmanipulierten Menschen in China, die Zulassung neuartiger Impfstoffe in beschleunigten Verfahren während der COVID- 19-Pandemie und aktuell die neue allgemeine Verfügbarkeit von generativen Sprachmodellen wie ChatGPT: Wenn wissenschaftsethische Fragen in der breiten Öffentlichkeit diskutiert werden, geht es meist um disruptive Technologien aus den Computer- und Naturwissenschaften, um Medizinethik oder um die fortlaufende Debatte zu Tierversuchen in der Forschung.
In vielen dieser Fälle gibt es klare gesetzliche Vorgaben, die auf Landes-, Bundes- oder EU-Ebene regeln, was Forschung darf (und was nicht). Doch wie sieht es in augenscheinlich weniger streng regulierten Forschungsbereichen aus? Wer ist Kontrollinstanz, und wieviel Eigenverantwortung liegt bei den Forschenden? Wir sprechen hierzu mit Anke Höffler vom Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft. Die Wirtschaftswissenschaftlerin und Alexander von Humboldt-Professorin forscht unter anderem zu den sozialen Ursachen von Gewalt in Entwicklungsländern und Konfliktregionen.
Frau Höffler, wann spielen ethische Überlegungen in Ihren Forschungsprojekten eine Rolle?
Frau Höffler: Das hängt natürlich in erster Linie von der genauen Forschungsfrage und der benötigten Methodik ab. Es gibt Projekte in meinem Forschungsfeld, die weitestgehend unbedenklich sind – beispielsweise, wenn wir öffentlich zugängliche makroökonomische Daten der Weltbank auswerten. Da stellt sich höchstens die Frage, wie die späteren Ergebnisse politisch verwendet werden könnten. Kritischer sind dagegen Forschungsfragen, die sich nur beantworten lassen, indem man Menschen befragt. Insbesondere dann, wenn es thematisch um Gewalt geht, wie in meiner Forschung. Da kommen neben der Frage nach Aspekten wie Datenschutz und der späteren Nutzung der Forschungsergebnisse auch die nach der Sicherheit und Unversehrtheit von Personen ins Spiel: die der Teilnehmenden, aber auch die meiner MitarbeiterInnen.
Können Sie vorab den Aspekt des Mitarbeiterschutzes an einem Beispiel konkretisieren?
Aktuell arbeiten wir an einer Studie zu den Mustern sexueller Gewalt unter Jugendlichen in Nigeria. Dafür haben wir 13- bis 17-jährige Jugendliche zu ihren Gewalterfahrungen befragt – auch solche, die nicht ins Schulsystem integriert sind. Das geht natürlich nur mit der Unterstützung lokaler PartnerInnen. Die kennen die örtlichen Begebenheiten und Verhaltensregeln und haben einen direkteren Zugang zur Bevölkerung. Trotzdem kann es bei den Umfragen zu sehr fragilen Situationen kommen. Im Fall der genannten Studie haben wir daher beispielsweise beschlossen, unsere Umfrage teilweise mit Stift und Zettel durchzuführen. Das wäre normalerweise nicht die Methode der Wahl, weil die Daten zur Digitalisierung und Auswertung händisch übertragen werden müssen. Wir wollten unseren MitarbeiterInnen jedoch keine Laptops oder Tablets mitgeben. Das hätte sie dem unnötigen Risiko von Raubüberfällen ausgesetzt.
Also geht es bei wissenschaftsethischen Überlegungen um das Abwägen verschiedener Risiken?
Häufig schon. Wir haben in diesem Fall das relativ geringe Risiko von vereinzelten Übertragungsfehlern in den Daten angenommen, konnten dafür aber unsere Befragung auf Jugendliche außerhalb des Schulsystems erweitern, ohne unsere Mitarbeitenden vor Ort einer erhöhten Gefahr auszusetzen. Ebenso wichtig wie die Sicherheit unserer MitarbeiterInnen sind aber selbstredend die Sicherheit und Rechte der Befragten. Eine essentielle ethische Voraussetzung für jede Umfragestudie ist beispielsweise, dass die Teilnahme freiwillig und ohne Zwang stattfindet und jederzeit abgebrochen werden kann. Dazu gehört auch, dass die Befragten über den Zweck der Umfrage informiert werden, bevor sie der Teilnahme zustimmen – eine sogenannte „informierte Einwilligung“.
Das klingt zunächst trivial. Was kann daran problematisch sein?
"In unserer Studie in Nigeria waren zum Beispiel viele der befragten Jugendlichen schreib- und leseunkundig. Da bedurfte es also ganz klarer Informationen in einfachster Sprache, die als Audioaufnahme vorgespielt wurden. Die Einwilligungsbestätigung erfolgte teilweise per Fingerabdruck statt Unterschrift. Die Umfrage selbst muss natürlich auch so verständlich wie möglich und in der örtlichen Sprache verfasst sein – im Beispiel der Nigeria-Studie ist das Yoruba. All das ist sehr aufwändig und komplex. Zu jeder neuen Umfragestudie gehört bei uns daher immer eine Pilotstudie, die sicherstellt, dass alles funktioniert, bevor wir die eigentliche Studie ausrollen. Das ist extrem wichtig, denn fast immer entdeckt man noch Schwachstellen, die vorab nicht bedacht wurden."
Anke Höffler
Ich kann ein sehr bedrückendes Beispiel aus einer unserer Studien zu familiärer Gewalt in Kenia geben. Da wurden Mütter befragt, wie häufig sie ihre Kinder mit dem Rohrstock schlagen. Nach der Pilotstudie mussten wir unsere Antwortmöglichkeiten abändern und um die Auswahl „mehrfach am Tag“ erweitern. Das hatten bei der Konzeption der Umfrage selbst unsere lokalen PartnerInnen nicht für möglich gehalten.
Sie sagten vorhin auch die Sicherheit der Befragten spiele eine Rolle. Inwieweit kann diese gefährdet sein?
Auf mehreren Ebenen: Interpersonelle Gewalt beispielsweise findet sehr häufig im direkten Umfeld der Betroffenen statt. Wir müssen daher verhindern, dass unsere Teilnehmenden allein aufgrund der Tatsache, dass sie uns über ihre Gewalterfahrungen berichten, erneut zu Opfern werden. Stellen Sie sich vor, ein gewalttätiger Ehemann bekommt mit, dass uns seine Ehefrau Auskunft zu ihren Gewalterfahrungen gegeben hat, und wird daraufhin erneut handgreiflich. Derartige Situationen müssen natürlich ausgeschlossen werden, zum Beispiel indem die Befragungen außerhalb des Haushalts stattfinden. In Fällen, in denen dies nicht möglich ist, geben wir den Befragten teilweise neutrale Fragebögen mit, die das eigentliche Thema der Umfrage verschleiern. Diese können sie dann bei Rückfragen durch ihr Umfeld vorzeigen. Sie sehen also, wissenschafts- ethische Fragen drehen sich häufig um methodische Details, die dringend im Vorfeld geklärt sein müssen.
Liegt all das in Ihrer Eigenverantwortung?
In der ersten Planung ja. Da diskutieren wir neue Forschungsvorhaben zunächst im Team. Ich habe das Glück, dass meine Gruppe sehr interdisziplinär ist. Sie besteht unter anderem aus ÖkonomInnen, PolitikwissenschafterInnen und PsychologInnen. Wir haben also bereits intern einen multiperspektivischen Blick auf die Dinge und können auf verschiedene Erfahrungsschätze zurückgreifen. Hinzu kommt die Expertise unserer örtlichen PartnerInnen, die uns zusätzlich auf lokale Besonderheiten aufmerksam machen. Dieser kollegiale Austausch ist enorm wichtig bei der Projektplanung und dem Erstellen von Ethikanträgen. Zusätzlichen Rat holen wir uns intern häufig beim Forschungssupport der Universität Konstanz oder extern – je nach Forschungsfrage – bei Organisationen, die Erfahrung mit heiklen Themen haben und daher beratend helfen können. Für eine Studie zu häuslicher Gewalt haben wir uns beispielsweise mit UN Women ausgetauscht. Über die Frage, ob eine Studie dann tatsächlich wie geplant durchgeführt werden kann, entscheiden unterschiedliche Gremien, basierend auf unseren Anträgen.
Welche Gremien sind das üblicherweise in Ihrem Fall?
Universitätsintern werden Forschungsvorhaben mit Menschen durch unsere Ethikkommission geprüft. Ohne deren positives Votum würden wir eine Studie nicht beginnen. Hinzu kommen ähnliche institutionelle Kommissionen unserer internationalen PartnerInnen. Die ethischen Vorgaben sind nicht an allen Hochschulen oder in allen Ländern gleich. Es müssen aber natürlich die Richtlinien aller Beteiligten berücksichtigt werden. Zu guter Letzt benötigen wir bei unseren Studien im Ausland in der Regel noch behördliche Genehmigungen auf Staats- oder zumindest Bezirksebene und die der Einrichtungsleitungen, wenn wir zum Beispiel mit Schulen oder Krankenhäusern zusammenarbeiten. In der Regel ist die Kooperationsbereitschaft hier jedoch sehr hoch, denn häufig gibt es in den Ländern, in denen wir arbeiten, Gesetzesvorgaben – beispielsweise zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonventionen. Und dabei hilft unsere Forschung ja, indem wir sozusagen Bestandsaufnahmen zu relevanten Themen erstellen und unsere Ergebnisse an die Einrichtungen und die Politik zurückspielen.
Gibt es auch im Anschluss an eine Studie Punkte, die in Sachen Wissenschaftsethik bedacht werden müssen?
Ja, eine ganze Reihe. Das reicht von Fragen des Datenschutzes – beispielsweise muss die Anonymität der Befragten stets gewährleistet werden – über das mögliche Missbrauchspotenzial von Forschungsergebnissen, das bedacht werden muss, bis hin zu der Frage, wie man die Studienergebnisse im Sinne von Open Science möglichst transparent vielen Menschen zugänglich macht. Es gibt jedoch auch hier noch einen Punkt die an der Studie beteiligten Personen betreffend, der mir sehr wichtig ist und den ich abschließend noch erwähnen möchte.
"Die Teilnehmenden unserer Umfragen haben oft schwere Gewalt erlitten. Wir müssen also zum einen bereits bei der Konzeption der Umfragen darauf achten, dass diese Personen nicht ein zweites Mal Schaden nehmen, wenn sie sich im Rahmen unserer Umfrage das Erlebte erneut ins Gedächtnis rufen, und zum anderen im Nachhinein im Fall der Fälle Hilfe anbieten."
Anke Höffler
Gibt es Indizien dafür, dass dies häufig passiert?
Glücklicherweise haben Studien zu diesem Thema sehr wenig Anhaltspunkte für eine erneute hohe Belastung von Umfrageteilnehmenden gefunden. Wir erhalten von unseren Befragten sogar häufig die Rückmeldung, dass sie froh waren, sich äußern zu dürfen – dass ihre Stimme und ihr Schicksal wahrgenommen werden. Nichtsdestotrotz achten wir in unseren Projekten darauf, dass wir im Notfall vor Ort intervenieren und unseren StudienteilnehmerInnen Wegweiser oder Hilfskontakte an die Hand geben können. Unser Studienleiter in Nigeria ist beispielsweise Psychologe und für die Jugendlichen auch nach der Teilnahme an der Befragung noch erreichbar. Nicht in der Funktion eines Therapeuten, sondern als jemand, der seriöse und vertrauenswürdige Hilfe vermitteln kann. Ähnliches gilt natürlich auch für unsere MitarbeiterInnen, die sich beim Durchführen der Studien sehr lange und intensiv mit bedrückenden Themen auseinandersetzen müssen. Deshalb organisieren wir hier momentan selbst eine psychologische Supervision für unsere Mitarbeitenden, da es ein solches Angebot von Seiten der Universität bisher nicht gibt. Es ist also nicht nur die physische Unversehrtheit aller an unseren Studien mitwirkenden Personen, die gewährleistet sein muss, sondern auch die mentale.
Die Wirtschaftswissenschaftlerin Anke Höffler wurde 2018 auf die Alexander von Humboldt-Professur für Entwicklungspolitik an den Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft der Universität Konstanz berufen. In ihren Forschungsprojekten untersucht sie unter anderem die sozialen Ursachen von interpersoneller und kollektiver Gewalt. Sie ist Principal Investigator im Exzellenzcluster „The Politics of Inequality“.
Headerbild: Universität Konstanz / Inka Reiter.