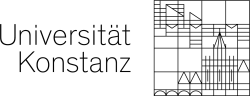Die Größe macht den Unterschied

Insekten wie Nachtfalter sind auf ihren nächtlichen Rundflügen einem häufigen Wechsel der Lichtbedingungen ausgesetzt. Das gilt bereits für ihren natürlichen Lebensraum – beispielsweise, wenn sie bei Vollmond von einer Lichtung in den Wald hineinfliegen. Um ein vielfaches stärker sind diese Schwankungen jedoch, wenn die Tiere durch bewohntes Gebiet fliegen und plötzlich auf Autoscheinwerfer, Straßenlaternen und Leuchtreklamen treffen.
„Die Tiere sind evolutiv überhaupt nicht an derart starke Helligkeitsschwankungen angepasst, da es solche Reize in der Natur ja eigentlich gar nicht gibt. Trotzdem müssen sie heutzutage vielerorts mit ihnen umgehen, was ihr Sehsystem und ihr Verhalten schnell an Extrempunkte bringt“, so die Konstanzer Biologin Anna Stöckl. Sie erforscht unter anderem, welche Verhaltensstrategien Tiere nutzen, um derart extremen Veränderungen ihrer Sinneswelt nicht vollkommen hilflos ausgeliefert zu sein.
Sich den Extremen aktiv entziehen
Werden wir Menschen nachts von einem Scheinwerfer geblendet, können wir leicht den Kopf abwenden oder die Augen zusammenkneifen, um dem grellen Licht zu entkommen. Sind wir selbst im Auto oder auf dem Fahrrad unterwegs, würden wir vielleicht außerdem unser Tempo drosseln, bis wir wieder ausreichend sehen können.

„Auch Tiere können durch Anpassung ihres Verhaltens aktiv bestimmen, was sie wahrnehmen, und so die extremen, menschgemachten Lichtschwankungen bis zu einem gewissen Grad kompensieren, indem sie zum Beispiel Abstand zu einer Lichtquelle halten oder sich von ihr abkehren.“
Anna Stöckl
Anna Stöckl ist Juniorprofessorin und Emmy Noether-Arbeitsgruppenleiterin an der Universität Konstanz. Für ihr Projekt „DynamicVision“, in dem sie den visuell gesteuerten Flug von Nachtfaltern erforscht, erhielt sie einen renommierten Starting Grant des Europäischen Forschungsrats in Höhe von 1,5 Millionen Euro.
Wer diese Verhaltensstrategien im Detail erforschen möchte, stößt jedoch schnell auf eine ganze Reihe technischer Probleme, angefangen mit der Frage, wie sie sich überhaupt beobachten lassen. Eine Besenderung der Tiere, die eine Bewegungsnachverfolgung per Funk erlauben würde, fällt bei Insekten alleine aufgrund des Gewichts der Sender meist weg. Mittel der Wahl sind stattdessen Videoaufzeichnungen, doch auch hier birgt die geringe Größe von Insekten einen entscheidenden Nachteil: Sollen auf einer Kameraaufnahme Details wie die Blickrichtung der Tiere erkennbar sein, darf der Versuchsraum eine gewisse Größe nicht überschreiten.
Bewegungsfreiheit ist der Schlüssel
„Wenn wir das Verhalten von Nachtfaltern mit hoher Detailtreue mittels kamerabasierter Methoden untersuchen wollten, waren wir bisher auf Versuchsräume von etwa einem Kubikmeter beschränkt“, schildert Stöckl. „Das hat dazu geführt, dass wir uns auf sehr spezifische Fragestellungen konzentrieren mussten, weil die Tiere auf so kleinem Raum nicht einmal im Ansatz die ganze Bandbreite ihres Verhaltenrepertoires ausspielen können.“ So fehlt den Tieren zum Beispiel schlicht die Bewegungsfreiheit, um Abstand von einer Lichtquelle zu halten oder um auf ihre maximale Fluggeschwindigkeit zu beschleunigen, bevor die nächste Wand erreicht ist.
In diesem Punkt schafft nun der Imaging Hangar der Universität Konstanz Abhilfe. Das knapp 1.900 Kubikmeter große Verhaltenslabor ist mit sorgfältig aufeinander abgestimmten Kameras bestückt, die den gesamten, fast turnhallengroßen Raum erfassen. Die installierte Videotechnik erlaubt eine millimetergenaue Nachverfolgung von Insektenflugbahnen mit einer zeitlichen Auflösung im Millisekunden-Bereich. Die Größe des Labors bietet den Tieren dabei den nötigen Freiraum, um ihre natürlichen Verhaltensstrategien anzuwenden.
360° Imaging Hanger
Kontrolle und Komplexität vereint
Den eigentlichen Versuchsaufbau im Imaging Hangar können wir uns wie folgt vorstellen: Ein aufwändiges Lichtsetup erlaubt die Simulation verschiedener Beleuchtungssituationen – von Tageslicht über Dämmerung bis hin zu Mondschein oder Sternenhimmel. Als Objekte im Raum werden vereinzelte Pflanzen am Boden aufgestellt, die die Tiere als Ziele anfliegen können, um zu landen oder zu fressen. Zusätzlich können gezielt künstliche Lichtquellen wie Scheinwerfer oder Hindernisse im Raum platziert werden, um die Flugumgebung komplexer zu gestalten.
„Für unsere Versuche beobachten wir kleine Gruppen von Faltern jeweils über eine ganze Woche hinweg. Dabei wechseln im Tagesverlauf die Lichtbedingungen, ganz ähnlich, wie es unter freiem Himmel der Fall wäre. Nur, dass wir in dem Fall die volle Kontrolle haben – sowohl über das Licht, als auch die weitere Versuchsumgebung“, schildert Stöckl. Das Kamerasystem erfasst währenddessen zu jedem Zeitpunkt die Position der einzelnen Tiere im Raum. Damit vereint der Imaging Hangar die detaillierten Kontroll- und Beobachtungsmöglichkeiten eines Labors mit den Vorteilen eines Freilandversuchs, bei dem die Tiere die notwendige Bewegungsfreiheit besitzen, um sich natürlich zu verhalten.
„Der Imaging Hangar schließt für uns eine wichtige Lücke zwischen Laborversuchen auf kleinstem Raum und der Freilandforschung. Das soll den klassischen Ansätzen nicht die Berechtigung absprechen. Im Gegenteil, die sind für das Gesamtbild unerlässlich. Aber der Imaging Hangar liefert uns ein wichtiges Puzzleteil, das bisher schlichtweg fehlte.“
Anna Stöckl
Bezogen auf ihr Forschungsprojekt können Stöckl und ihr Team nun viel komplexere Hypothesen aufstellen und testen und eine ganze Reihe von Faktoren gleichzeitig untersuchen: Wie schnell bewegen sich die Tiere bei verschiedenen Lichtverhältnissen? Welche Abstände halten sie zu Hindernissen und Lichtquellen? Und werden sie beim Anflug auf Pflanzen durch andere Objekte abgelenkt?
Echtes Neuland erschließen
Dadurch, dass diese Fragen auf der räumlichen Skala des Imaging Hangars bisher nicht untersucht wurden, ergaben sich bereits spannende, teils unterwartete Erkenntnisse. So wurden die von Stöckl untersuchten Nachtfalter beispielsweise ihrem sprichwörtlichen Auftrag, wie Motten ins Licht zu fliegen, alles andere als gerecht. „Wir haben die Tiere morgens so gut wie nie an den Lichtquellen sitzen sehen“, berichtet Stöckl. Und auch das Messen der Fluggeschwindigkeiten brachte Erstaunliches ans Licht: Die Tiere erreichen im Imaging Hangar Fluggeschwindigkeiten, die viel höher sind als alles, was bisher bei Nachtfaltern gemessen wurde. Und sie halten diese Geschwindigkeiten selbst unter schwachen Lichtbedingungen. „Das ist etwas, das wir ohne den Imaging Hangar niemals hätten beobachten können“, sagt sie.
© Elisabeth BökerDer Weinschwärmer ist eine Nachtfalter-Art, zu der Anna Stöckl forscht.
Mit Laborversuchen dieser räumlichen Größenordnung betreten Anna Stöckl und ihre KollegInnen an der Universität Konstanz also echtes Neuland. Für die nächsten Schritte geht es für sie jedoch vorerst zurück ins klassische Labor. „Wir möchten natürlich wissen, wie das Sehsystem der Tiere die hohen Fluggeschwindigkeiten unter schwachen Lichtbedingungen unterstützt – wie schnell verarbeitet es visuelle Reize überhaupt? Dafür müssen wir elektrophysiologische Untersuchungen am Sehsystem der Tiere durchführen, für die wir den Imaging Hangar nicht benötigen“, so Stöckl.
Nicht nur für Nachtfalter geeignet
Das Konstanzer Speziallabor bleibt unterdessen natürlich nicht ungenutzt, denn interessante Fragestellungen, die im Imaging Hangar erstmalig untersucht werden können, gab und gibt es reichlich: Von der Dynamik eines Heuschreckenschwarms mit mehr als 10.000 Tieren, über die Optimierung des Blättertransports auf einer Ameisenstraße von 30 Metern Länge, bis hin zur Selbstorganisation von Robotern, denen die Verhaltensregeln von Zebrafischen einprogrammiert wurden.
Als Core Facility des Konstanzer Exzellenzclusters „Kollektives Verhalten“ stehen der Imaging Hangar und seine Ausstattung sowohl internen als auch externen NutzerInnen für Forschungszwecke zur Verfügung. Dafür wird das technische Equipment durchgängig gewartet und erweitert, und Forschende bekommen technischen Support bei der Umsetzung ihrer Versuchsvorhaben.
„Der Imaging Hangar verändert die Art und Weise, wie wir Verhaltensforschung betreiben. Er erlaubt es uns an der Universität Konstanz, die Grenzen des Machbaren neu zu definieren, und Neurowissenschaft, Verhaltensforschung und Robotik auf wirkungsvolle Weise neu zu verknüpfen. Für die Zukunft planen wir, den Imaging Hangar zusätzlich mit Augmented und Virtual Reality für Tiere auszustatten. Wir werden also wohl bald Nachtfalter bei der Erkundung virtueller Blüten beobachten können.“
Iain Couzin, Professor am Fachbereich Biologie der Universität Konstanz, Sprecher des Konstanzer Exzellenclusters „Kollektives Verhalten“ und Direktor der Abteilung für Kollektivverhalten am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie.