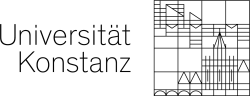Die Karrierewege müssen verlässlicher sein

„Egal, ob die Reform nun kommt oder nicht: Es ist vor allem wichtig, was die einzelnen Universitäten daraus machen“, sagte Andreas Keller am 24. April 2024 auf einer Podiumsdiskussion der Mittelbau-Initiative Konstanz und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Die angesprochene Reform betrifft das neue Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Für den Umgang damit hat die Universität Konstanz das Modell „Attraktive und verlässliche Karrierewege für exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler“ entworfen, das an diesem Abend Inhalt der Diskussionsrunde sein sollte.
Zu diesem Anlass kamen neben Andreas Keller weitere ExpertInnen zusammen: Malte Drescher, Isabell Otto und Sibylle Röth. Moderiert wurde das Gespräch von Manuela Reichle (Referentin für Hochschul- und Gleichstellungspolitik der GEW Baden-Württemberg).
© Universität Konstanz
Gleich zu Beginn hielt Malte Drescher fest, dass zu den Stärken einer Reformuniversität gehört, Dinge ausprobieren zu können und damit Innovationen voranzutreiben. In diesem Sinne wurde auch das Konzept „Attraktive und verlässliche Karrierewege für exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler“ entwickelt. Zunächst gab er einen kurzen Überblick darüber, wie die einzelnen Bestandteile des Titels zu verstehen sind, bevor er näher auf die Gliederung des Modells einging und die drei Abschnitte (Promotion, PostDoc-Phase, langfristige Karriereperspektiven) mit insgesamt 21 Maßnahmenpaketen erläuterte.
Als ein Vorteil des geschaffenen Modells hob Malte Drescher dessen partizipatives Konzept hervor. So wird zunächst in den Fachbereichen abgefragt, welche Bedarfe es jeweils konkret gibt – denn diese können sehr unterschiedliche sein.
Hierfür finden bereits jetzt und über die nächsten Wochen Gespräche des Rektorats mit den einzelnen Fachbereichen statt, um die spezifischen fachlichen Anforderungen der Karrierewege gemeinsam herauszufinden, so Isabell Otto. Auch für Sibylle Röth liegt die Stärke des Konzepts vor allem in der Tatsache, dass die Fachbereiche ein Mitspracherecht haben, sie schränkte aber ein: „Es herrscht Unsicherheit bei manchen Fachbereichen, wie das alles umgesetzt werden soll. Man muss daher noch abwarten, wie es sich entwickelt.“
Das Modell reagiere auf den Bedarf, allen WissenschaftlerInnen in frühen Karrierephasen bessere Bedingungen bereitzustellen und solle laut Isabell Otto zudem zu Chancengleichheit, Diversität und Gleichstellung beitragen. Die Zusammenarbeit mit dem Academic Staff Development und dem Referat für Gleichstellung, Diversity und Familienförderung sei daher eng und der geplante Zuschnitt werde auch durchaus noch weiter ausgearbeitet.
„So wollen wir sicherstellen, dass nicht bestimmte Gruppen bevorzugt und zum Beispiel Forschende mit Care- oder Familienaufgaben benachteiligt werden.“
Isabell Otto
Andreas Keller warf auf Bundesebene anschließend noch einen Blick auf das geplante neue Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Er gab zu bedenken, dass mit der beabsichtigten Verkürzung der PostDoc-Befristung von sechs auf vier Jahre (mit Option auf Verlängerung) der Druck auf die PostDocs erhöht würde – wenn die Befristung nicht mit einer verbindlichen Zusage zur Entfristung bei Erfüllung festgelegter Kriterien verknüpft werde. Er stellte zudem vor, in welchen Details das Gesetz diskutiert und entworfen wurde, und gab eine Kurzdarstellung der Reformpläne.
Andreas Keller merkte noch an, dass es neben der Professur mehr Dauerstellen geben müsse: „Und nicht nur als Trostpflaster, sondern in Größenordnungen. Denn Forschung und Lehre wird nicht von ProfessorInnen alleine gemacht.“ Wenn man Dauerstellen schaffen wolle, müsse man sich aber von dem Modell verabschieden, dass Stellen einer Professur zugeordnet sind, und zu einer Departement-Struktur übergehen. Malte Drescher hielt dagegen, dass die Struktur der Universität Konstanz dem schon weitgehend entspreche. Viele Stellen seien schon jetzt am Fachbereich und nicht an einer Professur aufgehängt. Andererseits brauche man die Professur-bezogenen Stellen aber auch, um konkurrenzfähig zu bleiben. Denn viele ProfessorInnen wollen bei der Berufung auch eine Zusage zu ihnen zugeordneten Stellen haben.
Für Sibylle Röth hat das Konzept einen „alles kann, nichts muss“-Charakter. „Ich hätte mir eher eine verbindliche Zielquote gewünscht, die das Ergebnis messbar machen würde“, sagte sie. Malte Drescher erwiderte, dass nicht eine Entfristungsquote das Ziel sei, sondern der Aufbau von optimalen Rahmenbedingungen für eine exzellente Universität. Nicht für alle Fachbereiche sei dafür die Einrichtung von Dauerstellen zielführend. Vielmehr müsse Qualifizierung, wie zum Beispiel die Habilitation ermöglicht werden, ergänzte Isabell Otto. Andreas Keller befürwortete die Quoten wiederum, die seiner Meinung nach auch nicht allgemein gehalten sein müssen, sondern durchaus fachbereichsspezifisch sein könnten.
Die Teilnehmenden der Podiumsdiskussion im Überblick:
- Malte Drescher: ehem. Prorektor für Forschung an der Universität Konstanz und Initiator des Modells; ab 1. Oktober 2024 Präsident der RPTU Kaiserslautern-Landau
- Isabell Otto: Prorektorin für Diversität und Karriereentwicklung an der Universität Konstanz
- Sibylle Röth: Co-Sprecherin der Mittelbau-Initiative Konstanz
- Andreas Keller: stellv. GEW-Bundesvorsitzender und Vorstandsmitglied für Hochschule und Forschung
- Manuela Reichle (Moderation): Referentin für Hochschul- und Gleichstellungspolitik der GEW Baden-Württemberg