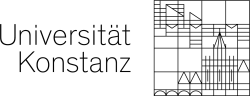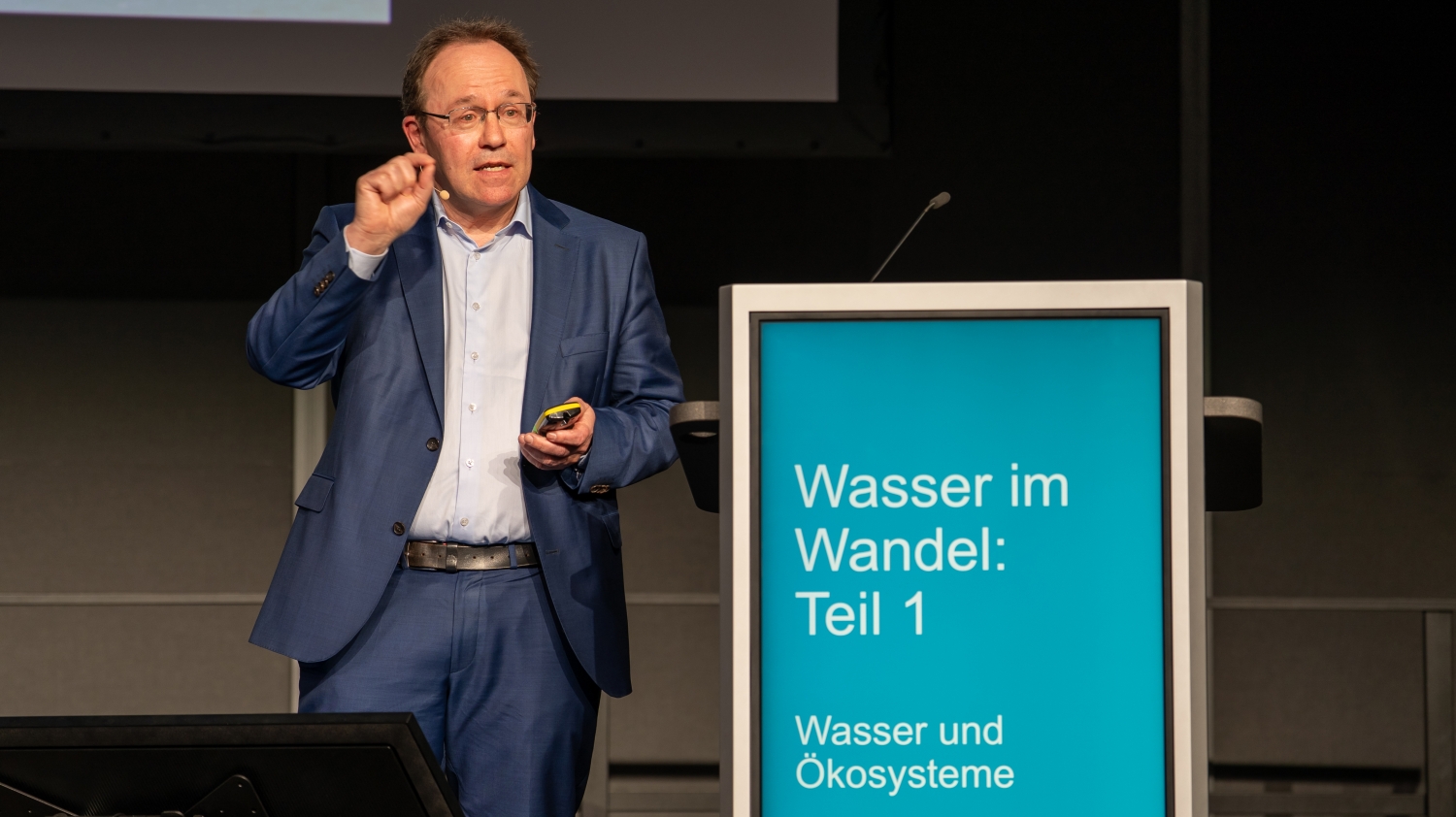„Wasser im Wandel“ – Gesellschaft und Forschung im Dialog

Der Wasserpegel des Bodensees auf Niedrigstand: Es hätte wohl keinen passenderen Zeitpunkt für die Konferenz „Wasser im Wandel“ des Konstanzer Wissenschaftsforums geben können. ExpertInnen aus der Wissenschaft diskutierten zwei Tage lang mit der Öffentlichkeit über die Lage unserer wohl wichtigsten Ressource, dem Wasser – hier am Bodensee, in der Arktis, weltweit.
Fernsehmoderator Felix Seibert-Daiker begleitete die Veranstaltung der Universität Konstanz und konnte mit seiner charmanten und offenen Art das Publikum direkt für sich gewinnen. „Wer von euch geht auch beim Zähneputzen durchs Zimmer? Und wer duscht effizient und umweltfreundlich?“ – eine scheinbar banale Frage, die jedoch auf ein ernstes Thema hinweist: den sorglosen Umgang mit Wasser.
Die Knappheit dieser lebenswichtigen Grundressource ist längst Realität und sie wird uns in Zukunft noch stärker betreffen. Hierzu belastbares Fachwissen zu liefern war Ziel der Veranstaltung: um über drängende Fragen rund ums Wasser zu informieren und aufzuklären. Diskussionen, Vorträge, Kurzfilme und Interviews: In lebendigen Formaten befassten sich ExpertInnen aus Deutschland und der Schweiz mit den heutigen und zukünftigen Auswirkungen von Wasserknappheit. Der Fokus lag dabei auf dem Wasser als Ökosystem, auf den Einflüssen von Wetter und Klima, aber auch auf dem Wasser als umstrittener Ressource.
Kosten durch den Klimawandel
Den Auftakt machte Klement Tockner, Generaldirektor der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, mit seinem Eröffnungsvortrag. Er machte auf die zehn globalen Risiken aufmerksam, welche wesentlich mit dem Klimawandel zusammenhängen: darunter Extremwettereignisse, Verlust von Biodiversität und Kollaps von Ökosystemen sowie der Verlust von natürlichen Ressourcen. Beim näheren Betrachten der Umweltschutzausgaben in Deutschland (Stand 2019) werde deutlich erkennbar, dass Geld für eine Prävention dieser Risiken vorliege.
© Universität Konstanz, Patrick DoodtKlement Tockner, Generaldirektor der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, hielt den Eröffnungsvortrag.
„Wir geben in Deutschland 76 Milliarden Euro für Umweltschutz aus. Wenn wir uns die Zahlen genau anschauen, dann gehen 94 % dieser Mittel für Abwasser- und Abfallwirtschaft sowie Beseitigung von Umweltbelastungen aus. Nur 6 % wird in die Forschung und Prävention investiert.“
Klement Tockner
Aus der ökonomischen Sicht sei das eine große Herausforderung, Prävention zu einem ökonomisch ertragreichen Modell werden zu lassen. Zugleich betont Tockner, dass in Deutschland 65 Milliarden Euro an Subventionen ausgegeben werden, die umweltschädigend seien. „Das heißt mit einer öffentlichen Hand finanzieren wir im gewissen Sinn die Belastungen unserer Natur und mit der anderen öffentlichen Hand muss die gleiche Menge investiert werden, um diese Schädigungen wieder beseitigen zu können,“ erklärt er.
Die Problematik wird im Wasserkonsum deutlich erkennbar. Pro Jahr werden in Deutschland etwa 16,4 Milliarden Euro für Plastikflaschen ausgegeben. Mit 1 Euro könne man 500 Liter Hahnenwasser bezahlen – oder 2-4 Liter in Flaschenwasser (Quelle gwf-wasser.de). Was können wir als Privatperson tun? Und was kann das Land tun? Einerseits wäre es sinnvoll, keine Plastikflaschen mehr zu kaufen und auf Mehrwegflaschen umzusteigen, so Tockner. Somit würde auch weniger Plastik verbraucht. Das Land hingegen könne von dem globalen Süden lernen. In Ruanda ist zum Beispiel Plastik allgemein verboten und wird beim Einreisen direkt von den Sicherheitsleuten kassiert. Und das beste: Das funktioniert schon seit gut 20 Jahren.
https://www.youtube.com/watch?v=mx3RCnvf4Ow
An Bord des Forschungsschiffs
Szenenwechsel: David Schleheck, Professor für Mikrobielle Ökologie und Limnische Mikrobiologie von der Universität Konstanz, nimmt sein Publikum mit an Bord des Forschungsschiffs „Robert Lauterborn“– am Freitag zunächst virtuell in einem Kurzfilm und am Samstag als großes Highlight höchstpersönlich. David Schleheck und seine Forschungsgruppe entnehmen wöchentlich Proben aus dem Bodensee – wie Mikroalgen oder Bakterien. Auch untersuchen sie das Phytoplankton, einzellige Pflanzen im Oberflächenwasser. Mit einer Multiparametersonde messen sie die Temperatur, den pH-Wert und Chlorophyll-Gehalt in der Wassersäule. Dafür muss die Sonde 40 Meter im Wasser abgesetzt werden. Die frischen Daten werden dann schnell vor Ort auf dem Schiff untersucht und auf dem Computer festgehalten. Viele Geräte, die die Forschenden verwenden, sind von den Wissenschaftlichen Werkstätten der Universität Konstanz erstellt worden. „Für die Werkzeuge sind wir sehr dankbar,“ so Schleheck.
Besucherinnen und Besucher auf dem Forschungsschiff „Robert Lauterborn“.
Das Schiff und seine Ausstattung konnten am Samstag persönlich betrachtet werden. Spannend war hier: Bakterien oder andere Mikroorganismen konnten von Interessierten unter dem Mikroskop untersucht werden. Um ein Haar wäre es nicht dazu gekommen: Passend zum Thema Wasserknappheit war das Anlegen des Schiffes aufgrund des niedrigen Wasserstandes im Bodensee nur knapp möglich, was die Relevanz des Veranstaltungsthemas eindrucksvoll unterstrich.
Apropos Seen: Wussten Sie, dass Seen weltweit mehr und mehr verschwinden? Karsten Rinke aus dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung erklärt: „Die Seen verschwinden, weil die ariden Gebiete durch den Klimawandel immer trockner werden.“ Gerade in Zentralafrika oder Amerika seien diese Folgen stark ersichtlich. Deutsche Seen seien ebenfalls überwiegend in keinem guten Zustand und es werde laut der Prognosen in den nächsten Jahren nicht besser. Grund hierfür sei der Sauerstoffverlust in wärmer werdendem Wasser, aber auch der Algenzuwachs in den Seen.
Die Folgen von Dürre
Mit Wasser, Wetter und Klima setzten sich die WissenschaftlerInnen am zweiten Konferenztag auseinander. Wenn es nicht regnet, bleibt das Wasser aus, soweit klar. Doch was passiert noch alles in Folge der Dürre? Kerstin Stahl, Professorin für Umwelthydrosysteme von der Universität Freiburg, berichtet darüber. Bevor sie auf die heutigen Herausforderungen und Probleme schaut, blickt sie einmal auf den Dürre-Kalender aus dem Trockenjahr 2018 zurück. Es wurde in dem Jahr so warm, dass viele Landkreise im Baden-Württemberg den Gemeingebrauch eingeschränkt haben. Man durfte z. B. Wasser nicht mehr für Kleingartenanlagen aus den Flüssen zum Bewässern nehmen.
Wenn man über das Thema Dürre nachdenkt, wird schnell klar, dass man zwischen verschiedenen Formen unterscheiden muss: meteorologische, landwirtschaftliche und hydrologische Dürre. Diese drei Bereiche sind zwar unterschiedlich, hängen jedoch eng miteinander zusammen. Fehlt es an Wasser, trocknet der Boden aus – und letztlich auch Flüsse und Seen. Doch woher kommt überhaupt noch Wasser, wenn die Trockenheit länger anhält? Kerstin Stahl erklärt, dass die Natur über gewisse Wasserspeicher verfüge. Dazu gehören unter anderem der Regenabfluss, die Schnee- sowie die Gletscherschmelze. Trotzdem seien die nutzbaren natürlichen Wasserressourcen sehr begrenzt – sie machen gerade einmal 1 % des weltweiten Wasservorkommens aus.
„Rund 70 % der Erdoberfläche sind von Wasser bedeckt – allerdings handelt es sich dabei größtenteils um Salzwasser, das für uns unbrauchbar ist. Nur etwa 2 % sind Süßwasser, und auch davon ist lediglich die Hälfte tatsächlich für den Menschen verfügbar. Der Rest liegt beispielsweise in tiefen Grundwasserschichten, auf die wir keinen Zugriff haben."
Moderator Felix Seibert-Daiker
Kerstin Stahl veranschaulicht anhand einer europäischen Datenbank die Folgen von Dürren: Die Landwirtschaft leidet unter ausgetrockneten Böden, Seen führen weniger Wasser und es kommt zu ernsthaften wirtschaftlichen Problemen. Mit dem Klimawandel werden Dürreperioden voraussichtlich häufiger und intensiver auftreten. Deshalb sei es umso wichtiger, dass alle Akteure ihre Interessen rund um das Thema Wasser besser aufeinander abstimmen, schlussfolgert Stahl. Die zentrale Frage bleibt: Wo und wie können wir Wasser sparen? Schon heute müssen wir Maßnahmen ergreifen, denn sie entscheiden über unsere Zukunft.
Impressionen
Wasserknappheit
Um Wasserknappheit ging es auch im dritten Schwerpunkt der Veranstaltung: „Wasser als umstrittene Ressource“. Moderator Felix Seibert-Daiker unternimmt ein Gedankenexperiment mit dem Publikum: „Wir stellen uns vor, wir sitzen irgendwo in Konstanz in der Innenstadt oder an der Seepromenade. Es gibt ein nettes Café aber für alle Menschen nur eine Wasserkaraffe. Wer bekommt zuerst Wasser? Sind das die Business-Leute oder Familien mit Kleinkind?“ Eine sehr berechtige Frage, wenn das Wasser in Zukunft immer knapper wird. Denn Nutzungskonflikte und Nutzungskonkurrenzen gebe es tatsächlich auch in Deutschland, schildert Martina Flörke, Professorin für Ingenieurhydrologie und Wasserwirtschaft an der Ruhr-Universität Bochum. Es sei aber kein flächendeckendes, sondern eher ein regionales Problem, unter anderem in den Bezirken Brandenburg, Thüringen, Darmstadt oder Sachsen-Anhalt.
Doch um welche Konflikte handelt es sich? Martina Flörke erklärt: „In 75 % der Wassernutzungskonflikte geht es um Quantität von Oberflächengewässern und in Grundwässern.“ Primär sind davon PrivatverbraucherInnen betroffen: Haushalte, die nicht an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen sind. Aber auch Ökosysteme und die Landwirtschaft werden davon beeinträchtigt. Wasserknappheit ist eine Herausforderung für die Wasserwirtschaft, die alle Sektoren betrifft. Wenn jetzt schon in manchen Ländern das Wasser teurer ist als das Benzin – dann kann sich der Konflikt zwischen Privatpersonen und Industrie in den nächsten Jahren noch verstärken.
https://www.youtube.com/watch?v=IBrUiRCcJHo
„Starke Wissenschaftskommunikation“
Mit „Wasser im Wandel“ knüpft das Konstanzer Wissenschaftsforum an ein Format an, das bereits in der vorausgehenden Konferenz „Klima im Wandel“ erfolgreich war: die Öffentlichkeit in den persönlichen Austausch mit ExpertInnen aus der Wissenschaft zu bringen. Zahlreiche ZuschauerInnen aus der Region nutzten die Gelegenheit und stellten interessiert Fragen, darunter auch Schülerinnen und Schüler.
Schirmherrin Petra Olschowski, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst aus Baden-Württemberg, zieht ihr Fazit zu der öffentlichen Konferenz der Universität Konstanz:
„Das ist wissenschaftliche Exzellenz, das ist Reformfreude, das ist das Gespür für wichtige Themen – und das ist starke Wissenschaftskommunikation.“
Die Veranstaltung wurde im Rahmen des forum.konstanz Ideenwettbewerbs und der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder an der Universität Konstanz gefördert.