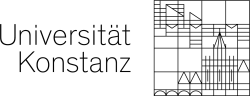Z’sämme!

Z’sämme! steht auf dem Plakat, das zur Wissenschaftskonferenz begrüßt. Ein kurzes und bündiges Zusammen! in Schweizer Mundart, sprichwörtlich für das Bekenntnis, Wissenschaft über die Ländergrenzen hinweg gemeinsam anzugehen. Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg hatte in Kooperation mit der Universität Konstanz zu der Konferenz eingeladen, um neue Impulse für die Wissenschaftsbeziehungen zwischen der Schweiz und Baden-Württemberg zu diskutieren. Was funktioniert? Wo gibt es noch Stolpersteine? Was können wir voneinander lernen? Ein übergreifendes Rahmenthema sind zudem die Verhandlungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union über ein institutionelles Abkommen, die 2021 abgebrochen wurden. Insbesondere geht es dabei um die Assoziierung an das Rahmenprogramm „Horizon Europe“. Nach erfolgreichen Sondierungsgesprächen wurden die Verhandlungen 2024 wiederaufgenommen.
Wissenschaftsministerin Petra Olschowski und Regierungsrätin Monika Knill (Kanton Thurgau) sitzen persönlich im Podium, gemeinsam mit den Hochschulrektorinnen Katharina Holzinger (Universität Konstanz) und Sabina Larcher (Pädagogischen Hochschule Thurgau). Moderiert wird die Veranstaltung von Markus Rhomberg, Geschäftsführer des Wissenschaftsverbunds Vierländerregion Bodensee.
© Universität KonstanzVon links nach rechts: Markus Rhomberg, Sabina Larcher, Katharina Holzinger, Monika Knill und Petra Olschowski.
Z’sämme! Der Titel wurde bewusst nicht mit einem Fragezeichen am Ende geschrieben, sondern mit einem Ausrufezeichen. Denn: Es läuft. Die Wissenschaftskooperationen zwischen der Schweiz und Baden-Württemberg florieren, wie am Beispiel der Universität Konstanz gezeigt wird: länderübergreifende An-Institute, gemeinsame Brückenprofessuren mit der Pädagogischen Hochschule Thurgau in Kreuzlingen, grenzübergreifende Lehrerbildung in der Binational School of Education, engmaschige Verknüpfung der Hochschulen im Wissenschaftsverbund Vierländerregion Bodensee. Dass Projektanträge von Forschenden aus Baden-Württemberg und der Schweiz gemeinsam gestellt werden, ist längst alltäglich.
Gelebte Ermöglichungskultur
Es läuft. Aber dass es läuft, das ist keine Selbstverständlichkeit. Jedes der heutigen Kooperationsprojekte bedeutete, dass die Satzungen, Verfahren und Regularien zweier Länder zusammengebracht werden mussten. „Jede einzelne Brückenprofessur ist erstmal Arbeit, eröffnet aber auch viele Chancen“, verdeutlicht Petra Olschowski. Aber: „Die Zusammenarbeit hat sich unglaublich gefestigt“, schildert Sabina Larcher, Rektorin der Pädagogischen Hochschule Thurgau, die Entwicklung über die Jahre hinweg. Die einstmals etwas holprigen Wege wurden leichter. Man kennt sich, weiß, wer die richtigen Ansprechpersonen sind. „Wir haben einen kurzen Draht zueinander. Die länderübergreifende Zusammenarbeit ist heute nicht mehr mit großen Hürden verbunden“, bestätigt Katharina Holzinger, Rektorin der Universität Konstanz. Wenn eines auf der Wissenschaftskonferenz deutlich wurde, dann, dass die Zusammenarbeit inzwischen sehr einfach geworden ist. Z’sämme!
„Die Schweiz ist mehr als nur ein Nachbar, wir sind Verbündete“, betont Petra Olschowski. Davon zeugen aktuell rund 130 Hochschulkooperationen zwischen Baden-Württemberg und der Schweiz. „Beide Länder sind Innovation Leader und sehen Wissenschaft als strategische Investition in die Zukunft“, führt die Ministerin aus. Das Interesse an Zusammenarbeit ist beiderseits groß, eine Ermöglichungskultur lichtete das Dickicht der Regularien. Die gemeinsame Philosophie laute „Schauen wir, was machbar ist“, bekräftigt Alexander Hasgall, Leiter Internationale Förderpolitik des Schweizerischen Nationalfonds (SNF).
Ein Schlüssel dafür sei, „die Hochschullandschaft nicht zu verpolitisieren, sondern Entwicklungen mit guten Rahmenbedingungen zu ermöglichen“, unterstreicht Monika Knill, Regierungsrätin des Kantons Thurgau.„Forschende wollen kooperieren. Unsere Aufgabe ist es, diese Kooperation zu ermöglichen. Und diese Kooperation soll einfach sein.“
Alexander Hasgall, Leiter Internationale Förderpolitik des Schweizerischen Nationalfonds (SNF)
Voneinander lernen
Natürlich gibt es auch die Unterschiede. „Was Grenzregionen spannend macht, ist die Frage: Wo ist man gleich? Wo hat man unterschiedliche Wertvorstellungen?“, zeigt Michael Grossniklaus auf, Leiter des Thurgauer Instituts für Digitale Transformation (TIDIT) und gleichzeitig Professor für Computer Science an der Universität Konstanz. Einen unterschiedlichen Blickwinkel der beiden Länder sieht er im Bereich der Auftragsforschung, also bei Kooperationen zwischen Wissenschaft und Industrie. In Deutschland beobachtet er einen kritischen Blick auf Auftragsforschung, in der Schweiz sei sie hingegen sehr gewünscht. Diese Unterschiede bedeuten aber keine Differenzen, sondern sind ein Anknüpfungspunkt, um voneinander zu lernen.
Rektorin Katharina Holzinger pflichtet ihm bei: „Im Bereich der Zusammenarbeit mit der Industrie zeigt uns die Perspektive der Schweiz, dass wir an der Universität Konstanz diesen Schritt noch stärker machen müssen.“ Gerade im Bodenseeraum als einer hoch industrialisierten, aber auch dienstleistungsstarken Region liege hier ein Potential für Technologietransfer ebenso wie für soziale Innovationen.
© Universität KonstanzNach 16 Jahren als Regierungsrätin des Kantons Thurgau scheidet Monika Knill im Mai 2024 aus dem Amt. Rektorin Katharina Holzinger bedankt sich bei ihr für die „jahrelange, sehr fruchtbare Zusammenarbeit mit hohem Commitment“.
Gemeinsamer Konsens der Veranstaltung: Alle Beteiligten begrüßen die Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und der Schweiz zur Assoziierung zum EU-Rahmenprogramm „Horizon Europe“. Auch die Partnerschaft zwischen Baden-Württemberg und der Schweiz wird weiter ausgebaut: Jüngst im Februar 2024 unterzeichneten das Land Baden-Württemberg und der Kanton Zürich ein Memorandum of Understanding, in dem die Forschungseinrichtungen beider Regionen dazu aufgerufen werden, ihre bestehenden Kooperationen auszuweiten und neue Partnerschaften aufzubauen.
Landrat Zeno Danner schildert abschließend die Wissenschaftskooperation zwischen der Schweiz und Baden-Württemberg als Beispiel für eine gelungene länderübergreifende Zusammenarbeit. Ein entscheidender Gelingensfaktor sei stets „das Vertrauen in die Expertise der jeweils anderen Organisation“ gewesen. Er appelliert dafür, dasselbe Grundvertrauen auch in anderen Bereichen der politischen Zusammenarbeit zu demonstrieren. Für eine Politik im Sinne eines Z’sämme!
Die ReferentInnen der Wissenschaftskonferenz „Z‘sämme | Zusammen!“:
- Petra Olschowski, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg
- Monika Knill, Regierungsrätin des Kantons Thurgau
- Prof. Dr. Katharina Holzinger, Rektorin der Universität Konstanz
- Prof. Dr. Sabina Larcher, Rektorin der Pädagogischen Hochschule Thurgau
- Dr. Jörn Achterberg, Direktor Internationale Zusammenarbeit, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
- Dr. Alexander Hasgall, Leiter Internationale Förderpolitik, Schweizerischer Nationalfonds (SNF)
- Prof. Dr. Michael Grossniklaus, Universität Konstanz und Thurgauer Institut für Digitale Transformation (TIDIT)
- Prof. Dr. Daniel Müller, ETH Zürich
- Moderation: Prof. Dr. Markus Rhomberg, Geschäftsführer des Wissenschaftsverbunds Vierländerregion Bodensee
Stream zur Podiumsdiskussion "Möglichkeiten und Perspektiven der Zusammenarbeit in Forschung und Wissenschaft"