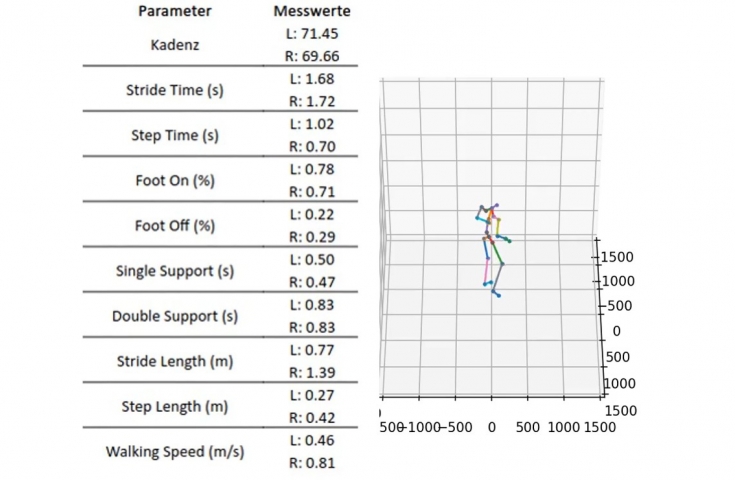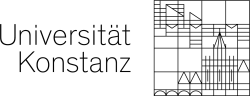Der Personaltrainer für die Hosentasche

Sind Sie schon einmal in die Situation gekommen, eine Physiotherapie in Anspruch nehmen zu müssen? Dann kennen Sie das vielleicht: In der Praxis wirken die Übungen unter Anleitung noch ganz einfach – mit logischen, leicht zu merkenden Bewegungsabläufen. Doch kaum sollen die Übungen in den eigenen vier Wänden wiederholt werden, schleichen sich erste Zweifel ein: Wie war noch mal die genaue Körperhaltung? Sollte die Bewegung nach vorne oder doch eher leicht seitlich vom Körper weg ausgeführt werden? Und wie musste dabei das Fitnessband angelegt werden? Dabei ist eine korrekte Ausführung der Übungen entscheidend für den Therapieerfolg, und falsche Bewegungen bleiben im schlimmsten Fall nicht nur wirkungslos, sondern verstärken die Beschwerden sogar.
Jetzt stellen Sie sich vor, Sie hätten rund um die Uhr jemanden an Ihrer Seite, der genau solche Fragen beantwortet – egal ob zu therapeutischen Übungen oder beim Fitnesstraining. Bei jeder Einheit, die Sie zu Hause durchführen, erhielten Sie direkte Rückmeldungen: Wurde die Übung korrekt ausgeführt? Oder müsste etwas anders gemacht werden, um den bestmöglichen Effekt zu erzielen? Was nach PersonaltrainerIn klingt und damit für viele unerschwinglich sein dürfte, könnte schon bald für alle zugänglich sein: als digitale Lösung für Smartphone und Tablet. Ermöglichen sollen dies moderne Bildanalyse-Technologien sowie Knowhow und der nötige Unternehmergeist aus Konstanz. Federführend bei der Entwicklung ist das Konstanzer Start-Up Subsequent GmbH.
Bewegungsanalyse per künstlicher Intelligenz
Die Subsequent GmbH steht – kurz gesagt – für hochmoderne Bewegungsnachverfolgung und -analyse mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI). Im Jahr 2021 vom Konstanzer Informatiker Manuel Stein gegründet, arbeitet das junge Unternehmen vor allem mit KundInnen aus dem Gesundheits- und Sportbereich zusammen. So war Subsequent bereits offizielle Datenpartnerin der österreichischen Fußballnationalmannschaft und kooperiert derzeit unter anderem mit dem Deutschen Eishockey-Bund oder dem Deutschen Alpenverein – mit letzterem in einem Projekt zum Speed Climbing.
Das Besondere an den KI-basierten Verfahren, die das Subsequent-Team entwickelt: Sie rekonstruieren aus einfachen 2D-Videobildern die dreidimensionalen Skelettbewegungen von Personen. Dafür benötigen sie nicht einmal besonders hochwertige Videoaufnahmen. Vergleichbare Bewegungsanalysen erfordern sonst meist teures, zeitaufwändig kalibriertes Equipment.
„Unsere Methoden ermöglichen es, menschliche Bewegungsabläufe im Raum anhand von Bildmaterial auszuwerten, das mit ganz normaler Consumer-Hardware – etwa einer Smartphone-Kamera – aufgenommen wurde. Und das in Echtzeit und mit vergleichsweise geringer Rechenleistung. Damit sind wir der Konkurrenz deutlich voraus.“
Manuel Stein, Gründer der Subsequent GmbH
Um die Nase weiterhin vorn zu behalten, entwickeln Stein und sein Team ihre Verfahren kontinuierlich weiter. Dabei arbeiten sie oft eng mit Forschenden der Universität Konstanz zusammen – so zum Beispiel im aktuellen Projekt „THERESA“, das vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt gefördert wird. THERESA ist ein Gemeinschaftsprojekt der Subsequent GmbH, der Hochschule Trier und der Arbeitsgruppe von Daniel Keim am Fachbereich Informatik und Informationswissenschaft der Universität Konstanz, in der Stein vor seiner Zeit als Gründer selbst promovierte.
Doch wie genau sieht die Zusammenarbeit im THERESA-Projekt aus – und wie bringt sie uns dem Ziel eines digitalen Personaltrainers näher? „In dem Projekt geht es darum, unser bereits sehr leistungsfähiges Bewegungstracking für Trainings- und Therapieübungen auf die nächste Stufe zu heben. Wir wollen künftig nicht nur die reinen Bewegungen im Raum analysieren, sondern auch den Einsatz von physiotherapeutischen Kleingeräten wie Hanteln oder Fitnessbändern in unsere Auswertungen einbeziehen. Das ist technisch bislang nicht möglich“, so Stein. Vorrangiges Projektziel ist es daher, neue KI-Modelle zu trainieren und zu testen, die diese erweiterten Funktionen ermöglichen sollen.
Eine breite Datenbasis als Schlüssel
Die ersten Schritte dafür wurden bereits im Frühjahr 2025 auf dem Campus der Universität Konstanz unternommen. Wer zu dieser Zeit den Imaging Hangar der Universität betrat, konnte Zeuge einer eher ungewöhnlichen Szene werden: Mitten in dem fast turnhallengroßen Hightech-Labor des Konstanzer Exzellenzclusters „Collective Behaviour“, in dem sonst das Verhalten ganzer Heuschreckenschwärme erforscht wird oder Robotergruppen lernen, im Kollektiv zusammenzuarbeiten, absolviert eine einzelne Sportlerin auf ihrer Yogamatte ein Workout mit verschiedenen Kleingeräten. Ihre Kleidung und die Trainingsgeräte sind an mehreren Stellen mit punktförmigen Reflektoren versehen. Ein wahres Meer aus Kameras – von professionellen Fernsehkameras über Action-Cams bis hin zu einfachen Handykameras und Web-Cams – ist dabei auf die Sportlerin gerichtet und erfasst jede Bewegung, während sie ihr 30-minütiges Trainingsprogramm durchläuft.
Was hier auf den ersten Blick passiert, ist schnell erklärt: Die unzähligen Kameras zeichnen das Trainingsmaterial für die KI-Modelle auf, die im THERESA-Projekt entwickelt werden und die später Aufnahmen unterschiedlichster Qualität und Herkunft zuverlässig auswerten können sollen. „Nur wenn wir unsere Bildanalyse-KIs mit möglichst vielfältigem Bildmaterial füttern, lernen sie, Bewegungen und Objekte aus verschiedenen Perspektiven, in unterschiedlichen Kontexten und bei variierender Bildqualität zu erkennen“, erklärt Philip Zimmermann, Chief Technology Officer bei Subsequent. „Aus demselben Grund haben wir die Trainingseinheit auch nicht nur von einer einzigen Sportlerin durchführen lassen, sondern nacheinander von insgesamt 25 Teilnehmenden – Männer und Frauen, Jung und Alt, sportlich Erfahrene und eher Ungeübte. Diese Vielfalt in den Trainingsdaten ist entscheidend für die spätere Robustheit der Modelle.“
Ohne Referenz keine Bewertung
Die vielen Kameras und der Platz, den sie benötigten, waren jedoch nicht der Hauptgrund, warum die Trainingsdatenerhebung im Imaging Hangar der Universität Konstanz stattfand – eine gewöhnliche Turnhalle hätte dafür ausgereicht. Entscheidend ist vielmehr, was sich unter der Decke des Hangars befindet: ein System zum Motion Capturing. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, das vor allem in der Film- und Videospielindustrie eingesetzt wird, um virtuelle Charaktere auf Basis der Bewegungen echter Menschen zu animieren. Dazu verfolgen spezielle Infrarotkameras die Position von Markierungen auf den Körpern von SchauspielerInnen. Die erhaltenen Bewegungsdaten werden anschließend auf die virtuellen Charaktere übertragen, um deren Bewegungen möglichst realistisch wirken zu lassen. Die Markierungen, deren Positionen im Raum dabei präzise nachverfolgt werden, sind kleine Reflektoren – genau wie die auf dem Trainingsoutfit unserer Sportlerin.
Das Subsequent-Team hat die Reflektoren auf der Kleidung seiner ProbandInnen gezielt an den Gelenkpunkten angebracht, also an den Stellen, zwischen denen die KI später die „Knochen“ des digitalen Skelettmodells rekonstruieren soll. „Wir erhalten dadurch sogenannte Ground-Truth-Daten – also Referenzwerte, die wir für die Entwicklung unserer Verfahren benötigen. Da das Motion-Capturing-System sehr genau arbeitet, können wir davon ausgehen, dass die erfassten Gelenkpositionen objektiv korrekt sind. Sie können uns deshalb als Maßstab beim Testen und Bewerten der Genauigkeit unserer Modelle dienen“, führt Zimmermann aus. Und die Reflektoren auf den Hanteln und Fitnessbändern? Sie ermöglichen ebenso die präzise räumliche Nachverfolgung der Kleingeräte während der Übungen – und beim Fitnessband über den Abstand der Reflektoren sogar die Erfassung des Dehnungszustands.
© Universität Konstanz, Inka ReiterDie Reflektoren sind nicht nur am Körper der Versuchsteilnehmenden angebracht, sondern auch an den Trainingsgeräten. So kann beispielsweise der Dehnungszustand des abgebildeten Fitnessbandes nachverfolgt und exakt berechnet werden.
Warum in die Ferne schweifen, …?
Während die technischen Aspekte des THERESA-Projektes von den InformatikerInnen der Subsequent GmbH und der Universität Konstanz vorangetrieben werden, kommt die therapiewissenschaftliche Expertise von der Hochschule Trier: Steffen Müller, Professor für Physiotherapie mit dem Schwerpunkt Bewegungswissenschaft und angewandte Biomechanik, und sein Team halfen bei der Auswahl der therapeutischen Übungen, bewerten Qualität und Intensität der Ausführung durch die SportlerInnen und werden helfen, die entwickelten KI-Modelle zu validieren. Denn diese sollen künftig nicht nur die Übungen und Geräte erkennen, sondern auch die dabei entstehenden Kräfte und die Trainingsintensität erfassen – für eine Analyse, die weit über das bloße Zählen von Wiederholungen hinausgeht und zusätzlich die anfangs geschilderte individuelle Leistungsbewertung mit Echtzeit-Feedback ermöglicht.
In seinen anderen Projekten arbeitet das Subsequent-Team häufig mit lokalen PartnerInnen aus dem Gesundheitsbereich zusammen – und das mit großem Erfolg. So wurde das Unternehmen in der Vergangenheit bereits mehrfach mit renommierten Gründer-Preisen ausgezeichnet, darunter der 1. Platz deutschlandweit im Wettbewerb „Digitales Start-Up des Jahres 2023“ des damaligen Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Und doch stellt sich die Frage: Muss man irgendwann in eine der deutschen „Start-Up-Metropolen“ ziehen, um dauerhaft innovativ zu bleiben und in der Gründungs-Szene mitmischen zu können? „Tatsächlich werden wir oft gefragt, warum wir nicht nach Berlin, München oder Karlsruhe gehen“, sagt Stein. „Aber wir haben hier in Konstanz alles, was wir brauchen: eine starke Universität, die uns von wissenschaftlicher Seite bei unserer Weiterentwicklung unterstützt, und engagierte PartnerInnen aus dem Gesundheitswesen, wie das Klinikum Konstanz oder die Kliniken Schmieder, die genau wie wir für Innovation brennen. Wir sehen also keinen Grund, wegzugehen. Im Gegenteil! Wir freuen uns, der Region, in der wir entstanden und gewachsen sind, als Unternehmen auch etwas zurückgeben zu können.“
Die Subsequent GmbH und die Universität Konstanz
Die Subsequent GmbH ist seit jeher eng mit der Universität Konstanz verbunden: 2019 trat Manuel Stein erstmals mit seiner Gründungsidee an Kilometer1 heran – die gemeinsame Startup-Initiative der Universität und der HTWG Konstanz. Lisa Kuner, Gründungs- und Fördermittelberaterin von Kilometer1 und Leitung der Stabsstelle Universitätsentwicklung, Forschung und Transfer der Universität Konstanz, unterstützt das Subsequent-Team bis heute in verschiedenen Belangen. Ein Jahr später warb das damalige Gründungsteam aus Manuel Stein, Philip Zimmermann und Marc Lüttecke – allesamt Absolventen der Universität Konstanz – ein EXIST-Gründungsstipendium des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie ein. Technisch-fachliches Mentoring erhielten sie in dieser Zeit von Daniel Keim, Professor für Datenanalyse und -visualisierung in Konstanz. Nach der Gründung der Subsequent GmbH 2021 ermöglichte eine Kooperationsvereinbarung die weitere Nutzung von Räumlichkeiten und IT-Infrastruktur der Universität. Es folgten mehrere vom Bund geförderte Kooperationsprojekte mit Konstanzer Forschenden – insbesondere aus der Informatik und der Sportwissenschaft.
Daniel Schmidtke
Verwandte Artikel: