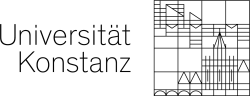Warum es an der Spitze ganz schön einsam sein kann

Fast jeder, der schon einmal in einer Organisation gearbeitet hat, kennt folgende Situation: Man muss dringend eine Aufgabe erledigen, aber ein Detail fehlt zur Lösung. Das könnte eine Excel-Funktion sein, die man nicht kennt, oder vielleicht mangelndes Wissen, wie die Kaffeemaschine funktioniert. Auf jeden Fall wird Hilfe benötigt.
Frage: Klopfen Sie a) an die Tür Ihres dominanten Chefs und fragen ihn nach Rat? Oder fragen Sie b) die ruhige Janice oder den hilfsbereiten Joe in der Buchhaltung, die immer freundlich lächeln, wenn man hereinkommt? Wenn Sie B) gewählt haben, sind Sie nicht alleine.
„Intuitiv vermeiden wir es, eine einschüchternde Person zu fragen, vor allem, wenn wir eine Wahl haben“, sagt Dr. Alex Jordan, Gruppenleiter am Konstanzer Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie und Principal Investigator am Exzellenzcluster Centre of the Advanced Study of Collective Behaviour der Universität Konstanz. „Aber im Laufe der Menschheitsgeschichte waren es typischerweise die stärksten und aggressivsten Individuen, die in Führungspositionen aufsteigen, auch wenn sie oft negative soziale Züge aufweisen.“
Dies wirft eine Frage für die Arbeitskultur auf: Wenn aggressive Individuen oft die mächtigsten sind, wir sie aber intuitiv meiden, wie mächtig sind sie dann wirklich?
Jüngst fanden Jordan und seine Kolleginnen und Kollegen am Centre for the Advanced Study of Collective Behaviour mit einer Studie, die das Gleichgewicht zwischen Macht, Dominanz und Einfluss untersucht, Antworten auf diese Frage. Ihre Ergebnisse, die im Wissenschaftsjournal „Proceedings of the National Academy of Sciences“ (PNAS) veröffentlicht wurden, deckten ein überraschendes Paradoxon auf: Die Charakterzüge, die zur sozialen Dominanz eines Individuums führen, können gleichzeitig ihren Einfluss verringern.
„Einfluss ist ein komplexes Merkmal, das sich auf viele Arten zeigen kann“, erklärt Jordan. „Aber die Prozesse, durch die Individuen normalerweise an Machtpositionen kommen und damit an das größte Einflusspotenzial, basieren in der Regel auf Dominanzeigenschaften wie Aggression. Unsere Studie zeigt, dass durch diesen Prozess die am wenigsten effektiven Einflussnehmer in Machtpositionen kommen können.“
Angesichts der eindeutigen Parallelen, die die Studie zu der menschlichen Organisationskultur aufweist, wäre es naheliegend anzunehmen, dass die Untersuchung an Arbeitskräften in einem Büro durchgeführt wurde. Diese Entdeckung wurde jedoch an Individuen gemacht, die in einer ganz anderen Gesellschaft leben, nämlich an Bewohnern in der gnadenlosen Jeder-gegen-jeden-Welt eines Aquariums.
© © The Jordan Lab, Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie
Fische als Metapher für schlechte Führungskräfte
Der 1,90 Meter große Australier Jordan stellt sich schon beim Anblick einer leeren Getränkeflasche einen Miniatur-Lebensraum im Wasser vor. Seit er denken kann, hält er Fische und kann die Anzahl an Aquarien, die er schon hatte, gar nicht mehr zählen. Bei Platzmangel landen die Aquarien regelmäßig in seinen Küchenschränken zu Hause oder auf seinem Schreibtisch.
Die vielen Stunden, in denen er in die Wasserwelt der Fische starrte und ihre Machtkämpfe beobachtete, haben ihn eines gelehrt: „Dominante Individuen zerstören Gemeinschaften“, sagt er. „Wenn man sie nicht genau im Auge behalten würde, würden sie innerhalb weniger Tage andere Fische getötet, ein riesiges Territorium in der Mitte des Aquariums besetzt und alle anderen an den Rand gedrängt haben.“
Für Jordan war es bereits vor seiner neuen Studie offensichtlich, dass dominante Individuen der Funktion von Gruppen schaden können. Dies brachte ihn auf die Idee, die Informationsflüsse in Gruppen zu untersuchen, die von aggressiven Individuen dominiert werden. Schließlich ist „effektive Informationskommunikation eine der Hauptaufgaben in jeder Organisation“, erklärt er. Jordan fragte sich, ob die dominanten Fische eine zentrale Rolle für den Informationsfluss spielen. „Nur wenige von uns würden mit einem Fiesling verkehren wollen, wenn sie die Wahl hätten. Deshalb dacht ich mir, dass die Bedeutung von dominanten Fischen geringer sein müsste, wenn es um Lernen und Informationsvermittlung geht.“
Portrait eines dominanten Fisches
Für die Studie wählten Jordan und sein Forschungsteam eine Buntbarschart, Astatotilapia burtoni, die einen Mikrokosmos dessen darstellt, was in einem von einem herrischen Chef geführten Büro passiert. Die Art bildet Gruppen mit strengen sozialen Hierarchien. Bunte, dominante Männchen kontrollieren Ressourcen, Territorium und Raum, während gräuliche, kleinere, untergeordnete Männchen an den Rand gedrängt werden.
„Man muss nur ihr Verhalten beobachten, und es wird klar, dass die dominanten Männchen andere Fische verjagen“, sagt Jordan. Für was sich das Team aber eigentlich interessierte, war für das bloße Auge nicht erkennbar. Um den Informationsfluss sichtbar zu machen, musste das unsichtbare Interaktionsnetzwerk der Fische aufgedeckt werden.
Für das Tiertracking, das auf maschinellem Lernen basiert, setzte das Team modernste Computertechnologien ein. Die von Doktorand Paul Nührenberg mit Hilfe des Labors des Computergrafikexperten Prof. Dr. Oliver Deussen entwickelte Software trainiert künstliche neuronale Netze zur Erkennung von Fischen und ermöglicht es so, die Bewegungen und Interaktionen aller Gruppenmitglieder zu verfolgen.
Sie filmten Gruppen mit dominanten und untergeordneten Fischen, die frei im Becken schwammen – was Jordan als „routinemäßige“ soziale Situationen bezeichnet – und wandten die auf maschinellem Lernen basierende Analyse zur Aufschlüsselung der Verhaltensunterschiede zwischen dominanten und untergeordneten Männchen an. „Selbst wenn wir die Fische jahrelang beobachtet hätten, hätten wir nie in diesem Genauigkeitsgrad quantifizieren können, was genau dominante und untergeordnete Männchen unterscheidet“, sagt Jordan.
https://www.youtube.com/watch?v=cCG5ArU7p0s&feature=youtu.be
Die Forschenden stellten fest, dass dominante Männchen häufig mit anderen interagierten – verhaltensmäßig spielten sie eine zentrale Rolle in sozialen Netzwerken –, aber von den anderen gemieden wurden. Was räumliche Netzwerke angeht, befanden sie sich an der Peripherie. Untergeordnete Fische waren dagegen räumlich stärker vernetzt, das heißt, sie waren über längere Zeiträume nahe bei anderen. „Das kann man vergleichen mit einem gemeinsamen Mittagessen mit Kollegen oder der Zeit, in der man mit anderen am Wasserspender plaudert“, erzählt Jordan.
Er hatte die Vermutung, dass diese passiven Verbindungen unter den untergeordneten männlichen Fischen in Einflussnetzwerken die größte Stärke sein könnten. „In Routinesituationen war der Einfluss der dominanten Männchen größer, weil sie die anderen Fische zwingen konnten, sich zu bewegen“, sagt er. „Was würde aber passieren, wenn wir die Fische aus diesem Zwangsgefängnis freiließen? Was, wenn sie eine Wahl hätten? Wem würden die Fische dann folgen?“
Wem würden Sie folgen?
Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, musste das Team eine schwierige Aufgabe für die Fische entwickeln, bei der diese Fische wählen konnten, wohin sie schwammen. Die Aufgabe, die sich die Forschenden ausgedacht haben, bestand darin, den Fischen beizubringen, ein farbiges Licht mit einer Futterbelohnung zu assoziieren. In der Tierverhaltensforschung ist es eine gängige Methode, die Tiere in sorgfältig regulierten Umgebungen unter Verwendung von Futterbelohnungen zu trainieren, bestimmte Aufgaben zu erledigen. „Eine Gruppe brauchte etwa vier Tage, um zu lernen, auf dieses farbige Licht zu reagieren und zu dieser Seite des Beckens zu schwimmen, um Nahrung zu holen“, beschreibt Jordan den Anfang.
Von diesen trainierten Fischen, „Trainer“ genannt, wurde ein dominantes oder untergeordnetes Männchen in eine neue Gruppe untrainierter Fische gesetzt. Die Forschenden wollten wissen, wie schnell diese Gruppe nun auf das Licht reagieren würde.
In Gruppen mit einem untergeordneten Trainer einigten sich die Fische schnell darauf, welchem Licht sie folgen sollten, bewegten sich zusammen dorthin und lösten die Aufgabe. Wenn der Trainer ein dominantes Männchen war, erzielte die Gruppe viel langsamer einen Konsens – wenn es ihnen überhaupt gelang.
(Der Text wurde aus dem Englischen übersetzt)