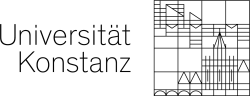Vorbereiten für den Extremfall

Die Geschichte des digitalen Kurses begann ganz fern der Polizei, sogar fern von Deutschland. In einem vom ERC geförderten Großprojekt hatte Kirsten Mahlke, Professorin für Kulturtheorie und kulturwissenschaftliche Methoden an der Universität Konstanz, zunächst Erzählungen des Terrors und Verschwindens nach der argentinischen Militärdiktatur untersucht. Was bedeutet es, wenn ein Angehöriger verschwindet? Wie trauert man um Tote, wenn es kein Grab gibt, keinen Leichnam, der den Tod begreifbar macht? Nach Abschluss des Projekts erkannten die Forschenden, dass ihre Ergebnisse viel weiter reichten, nämlich ganz allgemein in die Erfahrungen mit plötzlichem Tod und fehlendem Zugang zu den Toten. „Wenn Angehörige eines unnatürlichen Todes versterben, ob durch Suizid, Mord oder Unfall, also plötzlich aus dem Leben verschwinden, kann das ein tiefes Trauma bei denen hinterlassen, die die Realität des Todes in seiner Materialität nicht wahrnehmen können“, erklärt Mahlke. Anders als im Falle des Staatsterrors zwar, aber doch ähnlich wie bei Menschen in Argentinien, deren Angehörige die Militärdiktatur verschwinden ließ.

„Bei tödlichen Unfällen kann es Schwierigkeiten geben, den Leichnam zu sehen, möglicherweise, weil er so sehr verunstaltet ist oder an einem Ort liegt, der unzugänglich ist. Wie kann die Polizei die Todesnachricht so überbringen, dass es die Angehörigen nicht traumatisiert, haben wir uns gefragt.“
Kirsten Mahlke, Professorin für Kulturtheorie und kulturwissenschaftliche Methoden
So entstand die Idee, PolizistInnen darin zu schulen, Angehörigen Todesnachrichten möglichst professionell zu überbringen. Ihnen beispielsweise beizubringen, wie sie den Zugang zum Leichnam ermöglichen können oder über die letzten Worte bzw. den Unfallhergang in einer Weise informieren können, die es den Angehörigen möglich macht, den Tod überhaupt zu begreifen und danach besser zu verarbeiten.
Learning by doing
Für Mahlke war es das erste Transferprojekt. Und ihr spielten – wie sie selbst sagt – viele Zufälle in die Hand. In einer Spiegel-Sonderausgabe zum Thema Tod stieß sie auf einen Beitrag von Johannes Meurs. Der Polizist aus Kleve in Nordrhein-Westfalen berichtete davon, wie problematisch die Überbringung von Todesnachrichten in der eigenen Behörde sei. In einer Umfrage unter Angehörigen, die sie ein Jahr zuvor über unnatürliche Todesfälle im Familienkreis benachrichtigt hatten, erfuhr Meurs mit seinen KollegInnen, wie traumatisch die Überbringung der Nachricht für diese gewesen war und dass sie seither unter Depressionen bis hin zur Arbeitsunfähigkeit litten.
Daraufhin machte er es sich zur Aufgabe, etwas daran zu ändern: die Struktur in der Polizeibehörde Kleve entsprechend anzupassen, KollegInnen auf diese Aufgabe vorzubereiten und ein Team zusammenzustellen, um eine professionelle Überbringung der Todesnachricht gewährleisten zu können.
Türöffner und Unterstützer
„Johannes Meurs war der Türöffner für mich“, sagt Mahlke rückblickend. „Als ich ihn anrief, erklärte er sich dazu bereit, uns bei der geplanten digitalen Lernanwendung aus polizeilicher Sicht zu begleiten, seine Expertise beizutragen. Das Projekt sollte mit Studierenden der Hochschule für Verwaltung und Polizei Duisburg durchgeführt werden. Das wurde eine sehr angeregte und langandauernde Zusammenarbeit, in der wir mit Studierenden über das Thema und die Art und Weise diskutierten, wie bisher unterrichtet wurde.“
Neben Meurs unterstützte Tobias Trappe, der Ethikdozent der Fachhochschule für Verwaltung und Polizei, auf „unglaublich wertvolle Art und Weise das Team der Universität Konstanz“, schildert Mahlke. „Diese beiden Kooperationspartner – zusammen mit der Abteilung Technik, Logistik, Service der Polizei Freiburg – haben den Lehrgang dann gegen allerlei Hindernisse mit uns fertiggestellt.“
Ein sehr belastender Beruf
Interessant für die Forschenden: über die Benachrichtigung Angehöriger in Unglücksfällen hatten alle angehenden PolizistInnen, mit denen sie darüber sprachen, schon nachgedacht. Viele der Polizeistudierenden kamen aus Familien, in denen die Väter oder Großväter schon als Polizisten arbeiteten. Aufgrund der Erzählungen im Familienkreis waren sich die jungen Leute bewusst, dass es in ihrem Beruf um Leben und Tod gehen würde. „Dass man Zeuge eines Todesfalls werden kann, hat sie sehr beschäftigt, zum Beispiel, wenn ein Kollege im Dienst ums Leben kommt“, berichtet die Kulturwissenschaftlerin.
„Was mir selbst nicht so bewusst war: Es geht nicht nur um Angst davor, dass jemand im Einsatz zu Tode kommen könnte, sondern es gibt sehr viele Suizide unter PolizistInnen, weil es ein psychisch sehr belastender Beruf ist. Und dazu kommt noch als zusätzliche Aufgabe, Angehörige zu benachrichtigen.“
Kirsten Mahlke
Die meisten der angehenden PolizistInnen hatten schon ihre Praktika bei der Streife hinter sich. Gerade dort komme es vor, dass man an einen Ort gerufen werde, wo eine Leiche gefunden worden sei, so Mahlke. Todesnachrichten müssten also nicht nur KriminalpolizistInnen mit langer Erfahrung überbringen, sondern es passiere gerade auch BerufsanfängerInnen.
Auf Anweisung von oben
Die Konstanzer WissenschaftlerInnen erlebten die Zusammenarbeit mit einzelnen PolizistInnen als sehr kooperativ, informativ und offen, auch was die eigenen Perspektiven und Erfahrungen anging. „Offen sogar bezüglich Kritik“, betont Mahlke. „Ein Herausforderung war jedoch die nach außen hin sehr verschlossene Institution Polizei als Behörde. Im Inneren streng hierarchisch strukturiert, arbeitet diese Berufsgruppe immer auf Anweisung von oben. Es funktioniert wohl nicht anders.“
Die Struktur erkläre und rechtfertige sich durch die bestehenden gesetzlichen Vorgaben und nicht an Wünschen, Bedürfnissen, Kritik etwa von Angehörigen. „Transparenz und Öffnung für externe Einsichten stehen bei der Polizei nicht im Vordergrund. Daher wurde unser Angebot, einen neuen Kurs zu entwickeln, der über das hinausgeht, was bisher zum Thema Todesnachrichten unterrichtet wird, als Kritik an der Institution Polizei verstanden“, fügt sie hinzu.
„Die digitale Lernanwendung besteht unter anderem aus einer Folge von wichtigen Informationen zu den einzelnen Phasen in der Todesbenachrichtigung. Das beginnt beim Einsatz an der Unfallstelle, dass man nicht vergisst, wichtige private Gegenstände z. B. nach einem Verkehrsunfall von der Straße aufzulesen, weil sie persönlich für die Verarbeitung des Todes von Bedeutung sind. Wenn da ein Rucksack liegt mit persönlichen Gegenständen drin, geht es beispielsweise darum, alles sorgfältig zu verwahren, um es dann würdevoll auch überbringen zu können. Würdevoll und nicht in irgendeiner Form, die die Angehörigen dann noch mehr schockieren würde. Das war die erste Phase, die wir in der Anwendung behandeln.“ (Kirsten Mahlke)
Weitere Informationen zur Lernanwendung
Aus diesem Grund musste das Team aus Konstanz erst einmal grundsätzlich belegen, dass die Überbringung von Todesnachrichten nicht optimal läuft. Die von Johannes Meurs und seinen KollegInnen durchgeführte Umfrage unter mehr als 100 Angehörigen diente zunächst als Basis, um die Notwendigkeit der Lernanwendung darzulegen. Deren Ergebnisse wiederum mussten so kommuniziert werden, dass sie nicht als Kritik, sondern als verallgemeinerbarer Befund aufzufassen waren. „Die institutionelle Bereitschaft, sich von innen heraus zu reformieren und sich einer Kritik aus der Zivilgesellschaft zu öffnen, habe ich von Anfang an als sehr, sehr niedrig erlebt“, erzählt Mahlke, „und das ist auch so geblieben. So lässt sich der Erfolg des Transferprojekts vor allem auf einige wenige, aber sehr engagierte Personen im Polizeiumfeld zurückführen.“
In den Videos der Lernanwendung werden Gespräche mit Angehörigen nachgestellt. Quelle: Lernanwendung "Todesnachrichten verantwortungsvoll überbringen".
Persönliche Vorstellungsrunde
Die Polizei ist Ländersache, was die Verbreitung der Lernanwendung erschwerte. Es gab keine Möglichkeit, die Lernanwendung an zentraler Stelle für alle Polizeihochschulen vorzustellen. Mahlke musste also an die einzelnen Bundesländer herantreten, bzw. an die einzelnen Polizeihochschulen dort. Sie stellte fest, nur dort, wo Johannes Meurs und sie persönlich vorstellig wurden, stießen sie auf Interesse, auf großes Interesse. E-Mail-Marketing, Broschüren? Fehlanzeige.
Fazit der persönlichen Besuche: Inzwischen ist die digitale Lernanwendung im Land Berlin als Pflichtbestandteil in die Ausbildung an der Polizeihochschule aufgenommen worden. So sind mittlerweile zehntausende PolizistInnen in dieser Art und Weise geschult, Todesnachrichten zu überbringen. In Brandenburg ist es ein freiwilliges Angebot, was laut Mahlke gut angenommen werde. Und in Nordrhein-Westfalen werde in Kleve das von Meurs eingeführte Modell weitergeführt, ergänzt durch die Lernanwendung. Einzelne Interessensbekundungen kamen auch aus Bayern und dem Saarland. Auch in Baden-Württemberg wird der Kurs von zukünftigen PolizistInnen genutzt. Der Kurs wird regelmäßig von Interessierten aus Polizeikreisen in ganz Deutschland auch von der Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung der Universität Konstanz digital abgerufen.
Grenzen des Transfers
Den Transfer deutschlandweit erfolgreich zu leisten, hieße, in jedes Bundesland zu fahren und die Lernanwendung vorzustellen. Geht das zeitlich im Rahmen einer Professur? „Ist das letztlich nicht immer die Frage bei Transfer?“, meint Mahlke.
„Eine Frage, die wohl am meisten unterschätzt wird. Nichts bei Transferprojekten ist ein Selbstläufer. Keine öffentliche Institution wartet auf eine Geisteswissenschaftlerin, die ihr mitteilt, was dort möglicherweise anders gemacht werden könnte.“
Kirsten Mahlke
Wenn Verlage eine Lernanwendung vermarkten, haben sie Angestellte, die Businesspläne zu schreiben wissen, und eine Abteilung für Marketing und Werbung. „Diese Vermarktung ist etwas, was natürlich nicht nebenherlaufen kann. Und neben einer 100%-Professur, neben dem zugehörigen Lehrdeputat und der Selbstverwaltung geht das nicht“, erklärt die Kulturwissenschaftlerin entschieden.
Aber es gibt auch positive Überraschungen. Neulich bekam Mahlke von einer ehemaligen Absolventin, die inzwischen in Wuppertal Kriminaloberkommissarin ist, eine E-Mail. Sie wolle die Lernanwendung jetzt selbst in die Lehre einbringen, und das nicht mehr nur in der Polizeihochschule, sondern über MultiplikatorInnen weitervermitteln und dezentral in Kreispolizeibehörden einsetzen. „Einiges scheint dann doch von alleine zu laufen: Einzelne PolizeibeamtInnen gehen ganz kreativ mit diesem Kurs um. Die Behörden machen sich selbstständig Gedanken darüber, was zu ihnen am besten passt. Mal werden die darin enthaltenen Filme gezeigt, mal werden die Informationen gegeben, mal wird das Quiz geteilt“, freut sich Mahlke.
Marion Voigtmann
Verwandte Artikel: