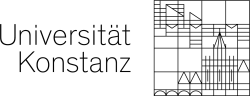Migration als Bedrohung oder Chance sehen?

Die internationale Immigration beginnt in Katalonien und Südtirol relativ spät. Spanien und Italien, ursprünglich Auswanderungsländer, entwickeln sich erst in den 1990er Jahren zu Einwanderungsländern. In beiden Regionen kommen primär Menschen an, die schlechter gebildet sind als die Einheimischen und aus einem unterschiedlichen Kulturkreis stammen – MarokkanerInnen in Katalonien und AlbanerInnen in Südtirol. Zwischenzeitlich haben 15% der katalonischen Bevölkerung ausländische Wurzeln, in Südtirol 8%. Die politische Akzeptanz von Migration könnte aber kaum unterschiedlicher sein.
Katalonien hat sehr unter der Finanzkrise gelitten und kämpft nach wie vor mit vielen ökonomischen Herausforderungen. Dennoch verhalten sich die politischen Eliten dort sehr aufnahmefreundlich. Dagegen herrscht in Südtirol, von der Finanzkrise nicht übermäßig tangiert, fast Vollbeschäftigung. Mehr noch, die Region bräuchte dringend Migration. Doch immer noch halten viele in der Politik an der Botschaft fest: Immigration brauchen wir nicht, davon haben wir schon genug. Dies überrascht, müsste die politische Haltung gegenüber Immigration doch, wenn man von der aktuellen Situation ausgeht, genau umgekehrt sein. Wie ist das zu erklären?
Gleichbehandlung oder Einheimische zuerst?
Die Politikwissenschaftlerin Christina Zuber analysiert Parlamentsdebatten in beiden Regionalparlamenten dahingehend, wie über Migration gesprochen wird: Wird sie eher als Bedrohung inszeniert oder als Bereicherung betrachtet? Sie untersucht Dokumente über die integrationspolitischen Maßnahmen, insbesondere die jeweiligen Integrationsgesetze. Und sie führt Interviews sowohl mit politischen Eliten aus verschiedenen Fraktionen als auch mit VerwaltungsbeamtInnen.
Die integrationspolitischen Maßnahmen, die die Regionen ergriffen, ähneln sich im Grunde. Doch Südtiroler Dokumente lassen das Prinzip „Einheimische first“ erkennen; zum Beispiel wurde im Integrationsgesetz von 2011 festgelegt, dass MigrantInnen bestimmte Rechte von Einheimischen erst nach fünf Jahren bekommen. Demgegenüber setzt man in Katalonien darauf, von ihrer Ankunft an alle gleich zu behandeln oder MigrantInnen besonders zu fördern, weil sie Unterstützung brauchen.
„In dem Projekt habe ich auch gelernt, dass es ganz viel darum geht, wie man eine Maßnahme verpackt“, meint die Wissenschaftlerin. So könne man die verpflichtende Teilnahme an Sprachkursen als Werkzeug verkaufen („Wir fördern dadurch eure Teilhabe an der Gesellschaft!“) oder als Zwang: „Wenn ihr euch nicht anpasst, dann schieben wir euch ab.“ In beiden Fällen gehe es darum, dass man die Sprache lerne, doch die Botschaft sei eine völlig andere.
Noch mehr jedoch unterscheiden sich die Diskurse über Migration in den Regionen, sagt Zuber:

„Mich beeindruckt nach wie vor sehr, dass ich in Katalonien parteienübergreifend keine einzige Aussage gefunden habe, die Immigration als Bedrohung betrachtet. Dabei hatte ich sämtliche Parlamentsdebatten zum Integrationsgesetz durchanalysiert.“
Christina Zuber
Die historische Dimension
Noch etwas fällt der Wissenschaftlerin sowohl bei den Parlamentsdebatten als auch bei ihren Interviews auf. Sehr häufig wurde die historische Erfahrung mit Migration ins Spiel gebracht.
„Das Interessante daran war, dass ich nie danach gefragt hatte, weil ich keine historische Erklärung erwartete. In Südtirol war immer wieder die Rede von: Wir hatten schon so viel Migration, wir wurden geradezu überrannt von den Italienern. Das hat nur Probleme gebracht.‘“
Christina Zuber
Die historische Erfahrung brachten auch ihre InterviewpartnerInnen in Katalonien zur Sprache, interpretierten diese aber anders: „Wir können das! Wir haben schon all die Spanier integriert. So konnten wir die katalanische Bevölkerung um mehrere Millionen vermehren.“ Die gigantische Bevölkerungsexplosion habe ihnen zu Größe verholfen, so der Tenor.
Christina Zuber nimmt sich historische Dokumente zur Zeit der Binnenmigration vor, die in beiden Regionen zwischen den 1920ern und den 1970ern stattfand, und stellt fest: Damals passte die ökonomische und demographische Situation ganz klar dazu, ob Migration als Chance oder Bedrohung wahrgenommen wurde.
© Christina ZuberDie Ausstellung 7,5 Millionen Zukünfte in Barcelona (2019) handelte davon, wie Millionen von internen und internationalen Migrant*innen Katalonien geprägt haben.
Binnenmigration in Spanien und Italien
Mussolini hatte das agrarisch geprägte Südtirol zwangsindustrialisiert. Industrielle aus der Lombardei siedelten ihre Unternehmen rund um Bozen an und brachten ihre italienische Führungselite mit. Die Südtiroler blieben die „armen Bauern vom Land“, ein absteigender Wirtschaftszweig ohne große Zukunftsperspektiven, während die BinnenmigrantInnen die Leitungspositionen im öffentlichen und industriellen Sektor besetzten.
In Katalonien, einer Avantgarde-Region der spanischen Industrialisierung, verhielt es sich umgekehrt. Migrantinnen kamen aus verschiedenen Regionen Spaniens dorthin, um die einfachen Arbeiterjobs zu machen, während die Industriellen dort – auch zu Francos Zeiten – die Katalanen selbst waren. Migration hilft unserer Wirtschaft, so war das Verständnis, und wenn die Einwanderer unsere katalanische Kultur annehmen, gewinnen wir in zweifacher Hinsicht. „Nach Francos Tod wurde die katalanische Identität dann von katalanischen Eliten gezielt umdefiniert“, verdeutlicht die Wissenschaftlerin.
„Nicht mehr die Abstammung bestimmte die katalanische Identität, sondern die Bereitschaft, katalanisch zu werden und auch die Sprache zu lernen. Da den neuen KatalanInnen ein sozialer Aufstieg winkte, waren die Anreize dafür sehr stark.“
Christina Zuber
Die damaligen PolitikerInnen sind weder in Katalonien noch in Südtirol mehr an der Macht. Wie kommt es, dass sich diese alten Ideen, die historisch sehr nachvollziehbar sind, so stabilisierten, dass sie sich auch auf die künftigen EntscheidungsträgerInnen auswirkten?
Ideelle Vermächtnisse
„Voraussetzung für so ein ideelles Vermächtnis ist, dass unter den Eliten Konsens herrscht, wie über ein bestimmtes Problem gesprochen wird. Es gibt also eine einheitliche Botschaft wie: Migration sehen wir als Chance für unsere Region!“, erklärt die Politikwissenschaftlerin. „Als nächster Schritt wird der Nutzen rhetorisch mit der Idee der nationalen Identität der Gruppe verknüpft: Wir sind Katalanen, eine Nation von Migranten, und haben immer schon von dieser Energie profitiert. So entsteht die Erzählung, dass die Nation eigentlich erst durch Migration zu dem geworden ist, was sie ist.“ Auf diese Weise wird die Botschaft Teil der kollektiven Identität. Und je öfter man sie wiederholt und je länger man sie verbreitet, umso schwerer wird es laut Zuber, zu einem späteren Zeitpunkt dagegen vorzugehen. Denn dann wendet man sich nicht nur gegen einen konkreten politischen Lösungsvorschlag, sondern greift die vorgestellte kollektive Identität an. Derselbe Mechanismus greife auch in Südtirol, nur mit einer anderen Botschaft.
Was aber, wenn diese ideellen Vermächtnisse aktuellen Bedürfnissen zuwiderlaufen? Wie sie sich möglicherweise überwinden lassen, erfahren Sie in den unten verlinkten Folgeartikeln.
Christina Zuber war ab 2015 Juniorprofessorin für Innenpolitik und öffentliche Verwaltung an der Universität Konstanz (Tenure Track). Seit 2021 ist sie dort Professorin für das Politische System Deutschlands.
Headerbild: La Diada, der Nationalfeiertag Kataloniens. Copyright: Christina Zuber
Marion Voigtmann
Verwandte Artikel: