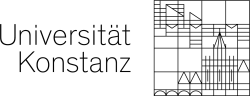Wir forschen immer über das, was wir am wenigsten verstehen

Wie kamen Sie auf Ihre Idee, Integration in Minderheitenregionen zu vergleichen?
Christina Zuber: In meiner Dissertation beschäftigte ich mich mit Parteien, die die Interessen von nationalen oder ethnischen Minderheiten in multinationalen Staaten – wie Spanien – vertreten. Auf einer Konferenz stellte damals eine Kollegin in Frage, ob der Begriff einer ethnischen Partei auf die Katalanen anwendbar sei. Denn diese würden ihre Zugehörigkeit zur katalanischen Nation nicht ethnisch, also nicht über ihre Abstammung definieren, meinte sie. Die Katalanen hätten ihren Begriff der Nationalität für Migranten so stark geöffnet, dass Nationalität durch andere Dinge definiert sei, etwa dadurch, dass man in der Region lebe und sich die katalanische Kultur und Sprache aneigne.
Als Beispiel nannte die Kollegin ein Referendum, bei dem alle in der Region Ansässigen mit abstimmen konnten. Die Idee war: Jeder, der auf unserem Territorium ist, gestaltet unsere Zukunft mit. Auch wenn du erst gestern aus Nigeria hergekommen bist, kannst du mit abstimmen. Ich fand auf Anhieb total interessant, dass die Katalanen sich einerseits als Minderheit gegen den Staat, also Spanien, verteidigen müssen und andererseits selbst so inklusiv agieren, dass jeder in ihrem nationalen Projekt mitmachen kann.
Was war Ihre Ausgangsfrage zu dem Projekt?
Wie gehen eigentlich Minderheiten, die versuchen, sich gegen den Staat abzugrenzen, selber mit Vielfalt um? Warum einige Regionen MigrantInnen mit einbezogen und andere sie auszuschließen versuchten, dazu habe ich bei meinen Recherchen zwar ein paar Fallstudien gefunden, nicht aber eine richtig gute Erklärung dafür.
Nach der Verteidigung meiner Dissertation entwarf ich aus dieser Fragestellung ein Postdoc-Projekt, mit dem ich mich dann bei der Thyssen-Stiftung um Förderung bewarb.
Projektförderung
Das erste Jahr des Projekts (2013) wurde durch ein Postdoc Fellowship der Fritz-Thyssen-Stiftung gefördert, was Christina Zuber Forschungsaufenthalte in Barcelona und Bozen ermöglichte. Als Fellow des Kulturwissenschaftlichen Kollegs Konstanz brachte sie das Projekt entscheidend voran. Dieses „Writing Retreat“, wie sie es nennt, finanzierte ihr das Exzellenzcluster „Kulturelle Grundlagen von Integration“ der Universität Konstanz von Oktober 2016 bis März 2017.
Katalonien war damit als eine Minderheitenregion gesetzt. Weshalb fiel Ihre Wahl auf Südtirol als Vergleichsregion?
Ich bin vergleichende Politikwissenschaftlerin, weshalb mein Zugang immer ein vergleichender ist. Daher kommt mein Ansatz, die sehr inklusive katalanische Antwort auf Migration im Kontrast zu einer anderen zu verstehen. Der Vergleich hilft dabei, eine Erklärung zu finden, wobei der zweite Fall als eine Art Kontrolle dafür dient.
Die Minderheitenregionen in Europa kannte ich von meiner Promotion schon recht gut, musste aber noch herausfinden, wie sie mit Migration umgingen. Letztlich bot sich Südtirol an, weil sich die beiden Regionen in sehr vielen Eigenschaften ähneln und sich trotzdem in diesem Punkt sehr unterschiedlich verhalten. In Südtirol treffen wir eben auf den ethnischen Nationalismus und auf große Ängste vor Immigration, die sich in den politischen Diskursen deutlich äußern.
Was war das Neue an Ihrem Projekt?
Es gab zwei Forschungsstränge, die sich mit Minderheiten beschäftigten. Bei dem einen ging es darum, dass eine Population an einem Ort blieb, aber sich die Grenze plötzlich verschob. Beispiel ist Südtirol, wo die Südtiroler zur Minderheit in einem anderen Staat, Italien, wurden. Andere Forschungsarbeiten wiederum befassten sich mit migrierenden Menschen. Das Ergebnis bleibt dasselbe, dass Menschen mit unterschiedlicher kultureller, ethnischer, religiöser und sprachlicher Zugehörigkeit innerhalb der gleichen Staatsgrenzen leben. Diese beiden Forschungsstränge wollte ich in meinem Projekt innovativ zusammenbringen und die unterschiedlichen Antworten bezüglich Integration erklären.
Das Projekt ist dann allmählich aber immer allgemeiner geworden, von einem recht engen Fokus auf regionalen Minderheiten und deren Kontakt zu Migration über die Migrations- und Integrationsforschung bis hin zu der Frage, ob die Theorie, die ich entwickelte, auch auf andere Politikfelder anwendbar sei.
Ihr Projekt hat sich also anders entwickelt als erwartet?
Heute sage ich, zum Glück war das Projekt viele Jahre in Arbeit, sodass zwei weitere Aspekte hinzugekommen sind: Ich habe mir die breiter gefasste Frage gestellt, wie lange zurückliegende Erlebnisse einer politischen Gemeinschaft langfristig den politischen Zugang zu Migration prägen können, auch wenn sich die Umstände radikal verändern. Es ging mir also darum, eine Theorie zu entwickeln, wie so ein Vermächtnis weitergegeben wird. Wie das funktioniert, wird nämlich in den meisten Arbeiten, die mit Vermächtnis-Argumenten operieren, nicht ausbuchstabiert – und davon gibt es gerade in der Forschung zu Migrationspolitik viele.
Ein dritter Punkt wurde sehr spät, eigentlich im Begutachtungsprozess erst, angestoßen: Die Gutachter fragten nach dem Verallgemeinerungspotenzial. Denn solche Vermächtnisse finden wir auch in anderen Politikbereichen. Am Ende leistete das Projekt auch noch einen Beitrag zur vergleichenden Policy-Forschung, die politische Inhalte in verschiedenen Politikfeldern erklären möchte.
Was fasziniert Sie an dem Thema der Integration?
Auf einer Konferenz habe ich einen klugen Satz gehört: Wir forschen immer über das, was wir am wenigsten verstehen. Das passt auf mich wie die Faust aufs Auge. Denn ich bin extrem kosmopolitisch. Ich gehöre zu den Menschen, die schon kaum nachvollziehen können, warum es moralisch gerechtfertigt sein könnte, dass wir für unsere eigene Familie eher eintreten als für Menschen, die gerade in der Ukraine bombardiert werden, geschweige denn für unsere eigene Nation. Für viele Menschen ist das aber eine ganz grundlegende Intuition. Wie wichtig es für die meisten Menschen ist, zu welcher Gruppe – Kultur, Religion, Ethnie, Nation – sie gehören, finde ich seit dem Studium extrem interessant! Deshalb lässt mich diese Forschung nicht los.
Im Jahr 2015 wurde Christina Zuber zur Juniorprofessorin für deutsche Politik und öffentliche Verwaltung an der Universität Konstanz ernannt (Tenure Track), wo sie 2021 zum ordentlichen Professor für deutsche Politik ernannt wurde. Sie ist Principal Investigator im Exzellenzcluster "The Politics of Inequality".
Claudia Marion Voigtmann
Verwandte Artikel: